Aus amerikanischer Sicht sind die Bürger der Währungsunion ziemlich arm. Zum jetzigen Euro-Wechselkurs von 1,14 Dollar dürfte das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in diesem Jahr bei 34.000 Euro liegen, verglichen mit 55.000 Euro in den USA. Das sind nur 62 Prozent des US-Wertes. Außerdem wächst die amerikanische Wirtschaft neuerdings deutlich rascher, und die Arbeitslosenquote ist auf 3,7 Prozent gefallen, während es im Euroraum immer noch 8,1 Prozent sind. Daher kann die Fed weiter die Leitzinsen erhöhen und so die Geldpolitik normalisieren, während sich die EZB das angesichts einer Kerninflationsrate von nur 1,1 Prozent und des mickrigen Wirtschaftswachstums auf absehbare Zeit nicht leisten kann. Europa bewegt sich in Richtung wirtschaftlicher Irrelevanz, meinen vor allem angelsächsische Medien und Wirtschaftswissenschaftler. Die Geschicke der Weltwirtschaft werden von den USA und China bestimmt.
Ich übertreibe, aber in mancher Hinsicht ist die Währungsunion tatsächlich kein Erfolgsmodell. In Italien, Griechenland, Portugal, selbst in Frankreich sehen das immer mehr Menschen so. Der Euro hat einen Konstruktionsfehler – seine Spielregeln erfordern in fast allen Mitgliedsländern eine jahrelange Sparpolitik, die nur wenig Raum lässt für Investitionen und Wachstum. Wir sparen so lange, bis wir alle wirklich arm sind. Insgesamt wird zu viel Wert auf niedrige Staatsdefizite und den Abbau staatlicher Schulden gelegt, und zu wenig wie sich das mittelfristige Wachstum beschleunigen lässt.
Wenn die EZB mit ihrer lockeren Politik nicht gegenhalten würde, wäre die Lage noch schlimmer. Viel kann sie allerdings nicht ausrichten, denn es ist so, wie einst Karl Schiller bemerkte: Du kannst die Pferde zur Tränke führen, saufen müssen sie schon selbst. Mit anderen Worten, das Umfeld müsste so sein, dass die niedrigen Zinsen auch zu mehr Ausgaben führen. Noch nicht einmal die Regierungen und Parlamente der 19 Mitgliedsländer reagieren aber auf die geldpolitischen Signale. Dabei ist nichts volkswirtschaftlich sinnvoller und normaler als wenigstens für die staatlichen Nettoinvestitionen Kredite aufzunehmen. Kein Häuslebauer strebt eine „schwarze Null“ an oder finanziert sein neues Haus komplett aus Ersparnissen. Unternehmen tun das auch nicht, wenn sie investieren. Wer wachsen und Vermögen aufbauen will, darf Schulden machen. Wenn es keine Schulden gibt, können Sparer nicht mit Zinseinnahmen rechnen.
Solange staatliche Schulden als gefährlich gelten, egal wofür sie aufgenommen werden, wird es nichts mit der EU. Die ständig sinkende Beteiligung an den Wahlen zum europäischen Parlament, das Vordringen der euroskeptischen Parteien und das Fehlen europäischer Initiativen, die die Bürger überzeugen oder vielleicht sogar begeistern, sind Indizien, dass das Projekt Europa an der Gleichgültigkeit der Betroffenen scheitern könnte. Immer neue Aufforderungen, sparsam zu haushalten, sind nicht die Strategie, mit der sich dieser Trend stoppen lässt. Es ist zum Gähnen, und ich kann es nicht mehr hören. Und Deutschland ist der Hauptschuldige, der strenge rückwärtsgewandte Zuchtmeister.
Wie die folgende Grafik zeigt, verfolgen weder die USA noch Japan, die beiden größten einzelnen Länder der OECD, das Ziel, ihre strukturellen Haushaltsdefizite zu beseitigen, jedenfalls nicht ernsthaft. Dennoch gelten sie seit einiger Zeit als sichere Häfen für Kapitalanleger, mit der Folge, dass sich ihre Währungen gegenüber dem Euro stark aufgewertet haben.
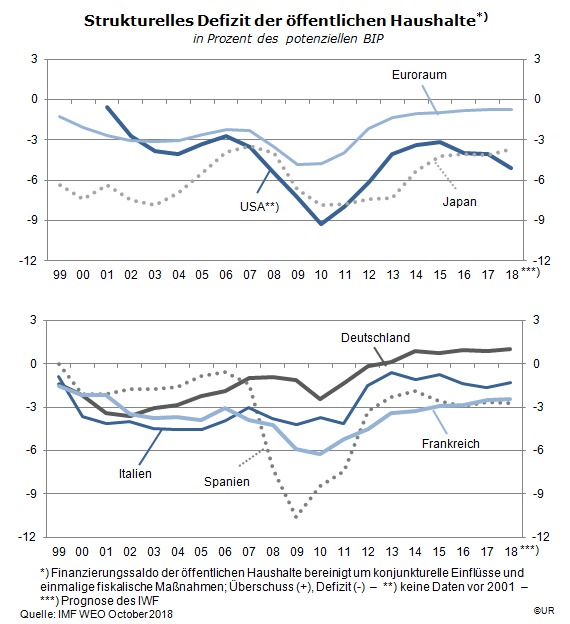
Kein Mensch weiß, wie groß ein strukturelles Defizit tatsächlich ist, aber ständig wird von Seiten Brüssels und Berlins gefordert, es zu beseitigen. Für Euroland insgesamt ist es schon beinahe geschafft, wenn man so rechnet wie der Internationale Währungsfonds. Deutschland hat demnach seit Jahren einen Überschuss, ebenso das arme Griechenland. Dort lag er zuletzt sogar bei 4,4 Prozent des sogenannten Produktionspotenzials – das Land ist zwar platt, aber es ist ein braver, vorbildlich sparsamer Schüler.
Wie es um die strukturellen Budgetsalden bestellt ist, hängt von den aktuellen Haushaltszahlen ab, sowie davon, wie rasch das Potenzial der Wirtschaft wächst. Wenn dieses seit Mitte 2009 trendmäßig nur um, sagen wir, jährlich 0,9 Prozent zunimmt, führt auch eine bescheidene Expansion des realen BIP schnell zu einem hohen Auslastungsgrad dieses Potenzials. Das gilt als inflationär und löst die Empfehlung der EU-Kommission aus, eine Sparpolitik zu betreiben, also das ohnehin schwache Wachstum weiter zu bremsen. Sind es dagegen, wie vor der großen Finanzkrise im Euroland üblich, etwas mehr als zwei Prozent, bedeutet die jährliche BIP-Wachstumsrate von 0,8 Prozent der vergangenen Dekade, dass die Staatsdefizite mehr oder weniger allein durch die schlechte Konjunktur erklärt werden können – und einen starken finanzpolitischen Impuls nahelegen. Die Strukturkomponente des Haushaltsdefizits wäre sehr gering und könnte vernachlässigt werden.
Bekanntlich hat sich die EU-Kommission die Theorie zu eigen gemacht, dass es 2009 einen Strukturbruch gab und das Produktionspotenzial seitdem mit einer Jahresrate von nur 0,9 Prozent wächst, dass die Haushaltsdefizite also vorwiegend struktureller Natur seien – weil de facto Vollauslastung herrsche – und daher eine (prozyklische) Sparpolitik erfordern. Diese Aussage betrifft den Durchschnitt der 19 Länder. Im Einzelnen gibt es starke Abweichungen davon. Aber, um es pointiert zu sagen, die europäische Finanzpolitik hat entscheidend dazu beigetragen, dass das Potenzialwachstum so stark zurückgegangen ist.
Insgesamt sind die finanzpolitischen Regeln Eurolands außerordentlich komplex, können daher in der Öffentlichkeit nur schwer vermittelt werden und leiden zudem darunter, dass die Datenbasis von Potenzialwachstum und Struktursalden unsicher ist und häufig korrigiert werden muss. Beim Brüsseler Thinktank Bruegel ist vor einigen Tagen eine Studie erschienen, die sich damit befasst, wie die Regeln vereinfacht werden können und wie sich die unheilvolle Tendenz zu unangemessener Austeritätspolitik vermeiden lässt. Die drei Autoren Darvas, Martin und Ragot – ein Ungar und zwei Franzosen – schlagen vor, dass „die nominellen Staatsausgaben nicht rascher zunehmen dürfen als das trendmäßige Wachstum des Einkommens, und langsamer in Ländern mit exzessiven Schulden. … Diese Regel verbindet finanzpolitische Disziplin mit makroökonomischer Stabilisierung.“ Sie zeigen, wie sie sich durch eine „Kombination aus Aufsicht (surveillance), positiven Anreizen, Marktdisziplin und politischen Nachteilen bei Regelverletzungen wirksam durchsetzen lässt“.
Es ist zu wünschen, dass die Diskussion über eine Reform der Maastricht-Kriterien und damit des institutionellen Fundaments des Euro endlich Fahrt aufnimmt. Diese Studie ist ein guter Ausgangspunkt. Ein „Weiter so“ kann sich Europa nicht mehr leisten.