Fast unbemerkt setzt der Staat die kräftige Expansion seiner Ausgaben fort. Das zeigen die volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, die in der vergangenen Woche veröffentlicht wurden. Weil die Einnahmen seit einigen Jahren stark steigen und der Schuldendienst wegen der niedrigen Zinsen rückläufig ist, kann er sich das leisten und trotzdem gleichzeitig die Schuldenquote weiter in Richtung 60 Prozent des BIP reduzieren. Wenn man Ausgaben und Einnahmen zusammen betrachtet, ist die Finanzpolitik angesichts der nach wie vor großen Outputlücke und des neuerlichen Überschusses im Gesamthaushalt eher restriktiv, wenn auch nicht so sehr wie noch vor wenigen Jahren. Was der Staat mehr ausgibt, nimmt er der privaten Wirtschaft erst einmal ab und senkt damit deren Ausgabenspielraum.
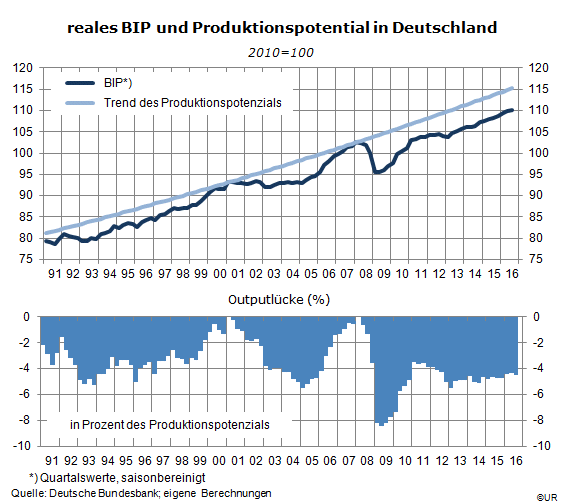
Wie sehen die Zahlen aus? In den ersten drei Quartalen dieses Jahres lagen die staatlichen Konsumausgaben inflationsbereinigt um nicht weniger als 4,5 Prozent über ihrem Vorjahreswert. Seit dem Frühjahr 2014 betrug die Zuwachsrate im Durchschnitt 3,4 Prozent – in den vier Jahren zuvor waren es nur 0,9 Prozent gewesen. Auch im Tiefbau, wo ein großer Teil der Aufträge vom Staat kommt, geht neuerdings die Post ab: Im dritten Quartal waren die Auftragseingänge real um nicht weniger als 9,7 Prozent höher als vor einem Jahr. Der Staat holt nach, was er vorher versäumt hatte: Von 2010 bis Mitte 2014 hatte es im Tiefbau praktisch kein Wachstum gegeben.
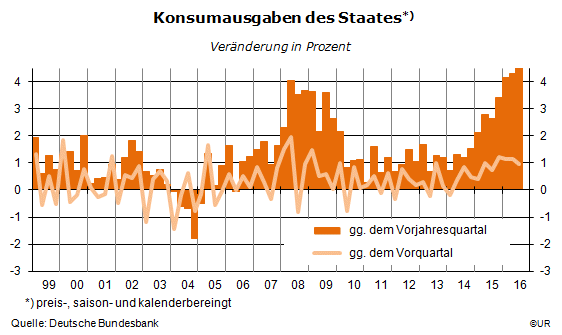
Die Verbraucher machen mit. Zwar nimmt die Anzahl der neuen Jobs nicht mehr so rasch zu wie bis Anfang 2016, als im Vorjahresvergleich noch ein Plus von 1,3 Prozent erreicht wurde – seitdem bewegt sich die Zuwachsrate in Richtung 0,4 Prozent. Es fällt aber offenbar bisher nicht schwer, Arbeit zu finden.
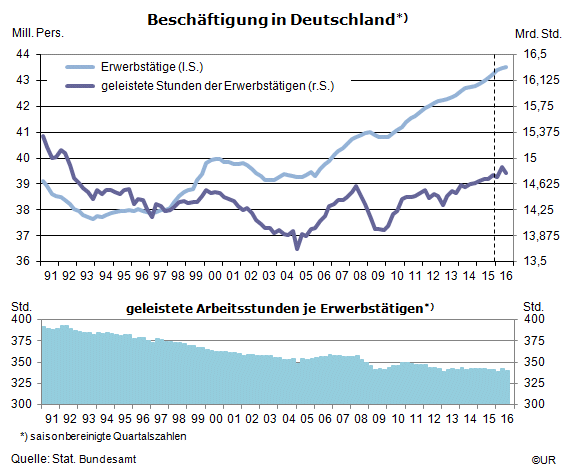
Das zeigt sich unter Anderem daran, dass die Haushalte ihre Nettoersparnisse in diesem Jahr etwas vermindert haben (auf rund 45 Mrd. Euro pro Quartal). Zuletzt hatten die sogenannten Masseneinkommen, die außer den Nettolöhnen und –gehältern auch Renten und monetäre Sozialleistungen enthalten, real ihr Vorjahresniveau um knapp drei Prozent übertroffen. Es wäre übertrieben zu sagen, dass der Konsum brummt, aber er trägt neuerdings signifikant zum Wachstum bei, nachdem er zuvor jahrelang mit realen Zuwachsraten von rund ein Prozent eher ein Bremsfaktor gewesen war. Jetzt reden wir über etwas mehr als 1,5 Prozent.
Von den Ausrüstungsinvestitionen und den Bauten gingen zuletzt kaum Wachstumsimpulse aus. Überraschend ist vor allem, warum es im Bau nicht richtig läuft. Nicht allein, dass die realen Hypothekenzinsen selbst für lange Fristen kaum mehr als ein Prozent betragen, gemessen am Volumen der Auftragseingänge an den Hochbau herrschen in der Branche geradezu boomartige Zustände – es übertraf in den ersten neun Monaten des Jahres seinen Vorjahreswert um nicht weniger als 14,5 Prozent. Die Diskrepanz zwischen Aufträgen und Produktion kann nur vorübergehend sein; irgendwann in der nahen Zukunft wird der Bau der zusätzliche Konjunkturmotor sein, der er schon seit einiger Zeit sein sollte.
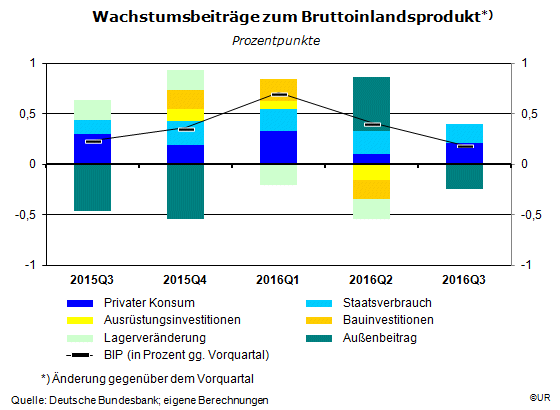
Dass sich bei den Ausrüstungsinvestitionen so wenig tut, war abzusehen, nachdem die realen inländischen Aufträge an die Investitionsgüterproduzenten (ohne sonstigen Fahrzeugbau) seit zwei Jahren stagnieren. Fragt sich nur, warum das so ist. An den Zinsen und Aktienkursen kann es nicht liegen, auch nicht an der schlechten Stimmung in der Wirtschaft – laut Ifo-Indikator war die Lage der Unternehmen selten so erfreulich wie heute – ebenso wenig wie am Wechselkurs des Euro, durch den die deutschen Löhne im internationalen Vergleich kaum steigen und Investitionen im Inland wieder attraktiver geworden sind. Ein Grund dürfte sein, dass die Outputlücke immer noch nicht geschlossen ist (warum investieren, wenn die vorhandenen Kapazitäten nicht voll ausgelastet sind?), ein anderer die Zunahme protektionistischer Tendenzen, die dazu geführt hat, dass der Welthandel erneut langsamer expandiert als das globale Sozialprodukt, und schließlich vielleicht auch, dass durch die Erfolge rechtspopulistischer Parteien leise Zweifel an der Zukunft des Euro aufgekommen sind und das europäische Projekt im Übrigen ins Stocken geraten zu sein scheint.
Jedenfalls ist die Investitionsschwäche keine gute Nachricht. Wir alle wünschen uns wieder ein rascheres Wachstum des Kapitalstocks und damit der Produktivität, weil das die Schlüssel für die Bewältigung der kommenden demographischen Probleme sind. Weniger beunruhigen muss dagegen, dass der Außenbeitrag seit dem Sommer 2015 das gesamtwirtschaftliche Wachstum per saldo gebremst hat. Für die Nachbarländer und die Zukunft des Euro ist es hilfreich, wenn Deutschland nicht immer noch größere Überschüsse in der Leistungsbilanz auftürmt, sondern endlich einmal die Rolle einer Konjunkturlokomotive übernimmt. Da die Konjunktur hierzulande besser läuft als im Rest des Euroraums, ist die relative Stärke der Importe und die relative Schwäche der Exporte nur natürlich. Außerdem vermute ich, dass wir es nur mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun haben – weil der schwache Euro schon dafür sorgen wird, dass der Außenbeitrag durch Erfolge auf den Drittmärkten wieder zunimmt.
Was lernen wir aus den neuen Zahlen? Der Aufschwung wird weitergehen, getrieben vom Bau und einer leicht expansiven Finanzpolitik (2017 ist Wahljahr!). Die Verbraucher scheinen ihre Finanzen im Griff zu haben und sind angesichts des kräftigen Anstiegs ihrer Einkommen und der guten Lage am Arbeitsmarkt in der Lage und bereit, wieder mehr auszugeben, so dass sie die wichtigste Stütze der Konjunktur bleiben. Im Außenhandel steht nach der Abwertung des Euro eine Wende in Richtung positiver Wachstumsbeitrag bevor. Von den Ausrüstungsinvestitionen sollten wir uns wegen der vielen Unsicherheiten erneut nicht allzu viel erwarten – Hoffnung macht aber, dass die Löhne wegen des hohen Beschäftigungsniveaus von nun an stärker steigen dürften und so die Unternehmen zwingen, ihre Betriebe zu modernisieren. Angesichts der guten „Fundamentals“ des Euroraums können sie zudem nicht darauf setzen, dass der Euro auf Dauer eine schwache Währung bleiben wird und sie dadurch für immer Preisvorteile haben werden.
Und die Inflation? Zunächst einmal sieht es nicht mehr nach Deflation aus, vor allem weil die Outputlücke nicht mehr größer zu werden scheint. Außerdem steckt inzwischen schon Einiges an Inflation in der Pipeline – die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte sind in den letzten sechs Monaten mit einer annualisierten Rate von 3,0 Prozent gestiegen, die Ausfuhrpreise mit einer von 1,9 Prozent, und die Einfuhrpreise mit sogar 5,9 Prozent. Es sieht nicht danach aus, dass die EZB ihre Politik weiter lockern müsste. Vielmehr steht im Verlauf des nächsten Halbjahres die Zinswende bevor.