An den Kapital- und Devisenmärkten ist seit einiger Zeit die These im Umlauf, dass der große Wachstumsunterschied zwischen den USA und Euroland vor allem damit zu tun hat, dass die Europäer eine zu restriktive, wenn nicht sogar prozyklische Finanzpolitik betrieben, während den Amerikanern Budgetdefizite ziemlich egal seien, Hauptsache die Nachfrage, einschließlich der staatlichen, expandiert insgesamt so stark, dass der Arbeitsmarkt brummt, was vor allem in Zeiten niedriger Inflationsraten eine risikolose Strategie sei.
Die Zahlen stützen diese Argumentation: Seit dem Tiefpunkt der letzten Rezession im Frühjahr 2009 bis zum vierten Quartal 2018 ist das reale Bruttoinlandsprodukt der USA um 23 Prozent gestiegen, das der Währungsunion dagegen nur um 14 Prozent. Bei den neu geschaffenen Jobs war es ähnlich: dort +11 Prozent, hier +5 Prozent. In Amerika liegt die Arbeitslosenquote bei 3,9 Prozent, im Euroraum immer noch bei 7,9 Prozent. Im selben Zeitraum hat sich der Euro zudem von $1,40 auf $1,15 verbilligt, hat sich also gegenüber dem Dollar stark abgewertet, trotz der restriktiven europäischen Finanzpolitik und trotz der Tatsache, dass die europäische Leistungsbilanz seit Jahren einen großen und steigenden Überschuss aufweist, die amerikanische dagegen ein gewaltiges Defizit. In derselben Währung gerechnet, hat sich der Unterschied beim BIP pro Kopf im vergangenen Jahrzehnt dramatisch ausgeweitet – der europäische Wert liegt zurzeit um 36 Prozent unter dem amerikanischen.
Woran genau das gelegen hat, ist schwer zu sagen, aber die Unterschiede in der Finanzpolitik haben sicher eine Rolle gespielt. Manche würden sagen, das sei kein Wunder, weil sich die Amerikaner große Staatsdefizite leisten können, viele der Euro-Mitgliedsländer dagegen nicht. Schließlich wird die US Treasury stets in der Lage sein, ihre Dollarschulden zu bedienen, und seien sie noch so hoch, während es für die einzelnen europäischen Regierungen nicht möglich ist, die EZB zum Ankauf ihrer Schulden zu zwingen. Griechenland und Italien können durch eine expansive Finanzpolitik viel eher als die USA an einen Punkt kommen, wo sie auf Neuschulden so hohe Zinsen zahlen müssen, dass das soziale Unruhen auslöst – ohne dass ihnen die EZB helfen kann.
Ein Land, das über eine eigene Zentralbank verfügt, hat viel größere Spielräume in der Finanzpolitik als ein Land, wo das nicht der Fall ist. Der japanische Staat hat Bruttoschulden in Höhe von etwa 230 Prozent des BIP, aber da kein Anleger daran zweifelt, dass die Bank von Japan dafür sorgen wird, dass sie stets bedient werden, ist der Yen nach wie vor eine der härtesten Währungen der Welt; die Renditen der Staatsanleihen sind bis zu einer Laufzeit von zehn Jahren negativ.
Da die „disziplinierteren“ Länder des Euroraums aus verständlichen Gründen befürchten, dass sie (und nicht die EZB) zur Kasse gebeten werden, wenn hochverschuldete Mitgliedsländer Probleme mit ihrem Schuldendienst bekommen, haben sie Regeln durchgesetzt, die auch in schwierigen konjunkturellen Situationen eine lockere Finanzpolitik verhindern, also gerade dann, wenn sie dringend benötigt wird. Italien wurde zuletzt von der EU-Kommission gerügt und verwarnt, als für 2019 ein Budget vorgelegt wurde, das ein Defizit von 2,4 Prozent des BIP vorsah. Kein Hahn kräht danach, dass die USA auf ein Defizit von fünf Prozent zusteuern, Japan auf eins von drei Prozent.
Wie die folgenden Grafiken zeigen, gibt es in den größten Volkswirtschaften unter den entwickelten Ländern keinen erkennbaren Zusammenhang zwischen Staatsschulden einerseits und BIP-Wachstum und Inflation andererseits.
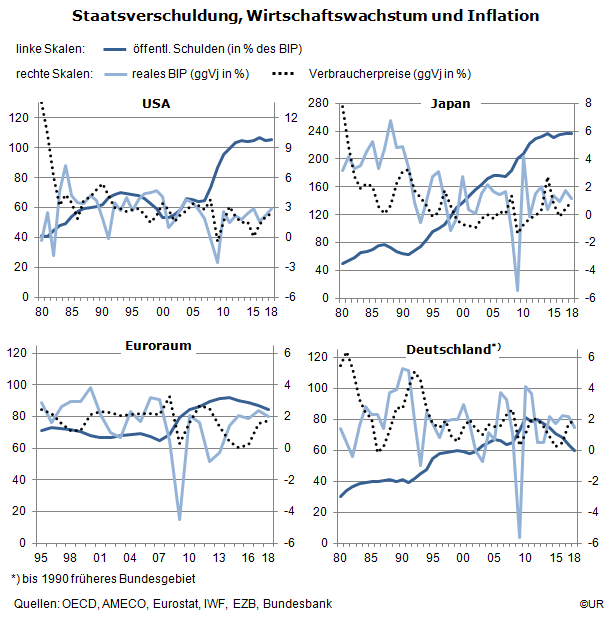
Eins der gewichtigsten Argumente gegen staatliches Schuldenmachen war, dass dies am Ende zu höheren Steuern führt. Abgezinst auf den heutigen Tag neutralisieren diese die expansiven Nachfrageeffekte durch schuldenfinanzierte zusätzliche Ausgaben. Resultat: Es gibt keine positiven konjunkturellen Effekte und der Staat sollte es daher sein lassen (Robert Barro, 1974). Zudem würden die Zentralbanken, die sich ja zum Ziel gesetzt haben, Inflation zu verhindern, in einer Welt freier Kapitalströme stets für ein (reales oder nominales) Zinsniveau sorgen, das höher ist als die Zuwachsrate des (realen oder nominalen) BIP – allein dadurch würde die Schuldenlast im Laufe der Zeit aber relativ zum BIP immer schwerer. Irgendwann wäre dann Schluss mit Lustig.
Nun hat Olivier Blanchard vom MIT, der frühere Chefvolkswirt des IMF, in seiner Presidential Lecture bei der American Economic Association in diesem Monat darauf hingewiesen, dass mit Ausnahme der fünfziger Jahre in allen folgenden Jahrzehnten die Zuwachsrate des BIP höher war als das Zinsniveau. Wenn das so ist und die Ausgaben die Steuereinnahmen nicht ständig übersteigen, werden die Schulden in Relation zum BIP im Zeitverlauf immer geringer. Nachträgliche Steuererhöhungen zur Verminderung der Schuldenlast wären nicht erforderlich, die Schulden verschwänden von alleine.
Auch gegenwärtig nimmt das BIP in den OECD-Ländern mit Raten zu, die höher sind als das Zinsniveau. In den USA expandiert das reale BIP im Verlauf mit etwa drei Prozent, der Leitzins, also die Fed Funds Rate, liegt nominal bei 2,4 Prozent, die 10-jährigen Treasuries bei 2,7 Prozent, das sind real nur 0,5 Prozent beziehungsweise 0,8 Prozent. In Japan nimmt das reale BIP mit einer Rate von etwa ein Prozent zu, während die Leitzinsen und die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen real etwa -0,35 Prozent betragen. Und hier bei uns? Das reale BIP wird nach der jüngsten Prognose der Regierung 2019 um 1,0 Prozent höher sein als 2018, der reale Hauptrefinanzierungssatz wird dagegen bei -1,5 Prozent, die realen Renditen vielleicht bei -1,3 Prozent. Das ist eine beachtliche Differenz, die – neben dem wahrscheinlichen Haushaltsüberschuss – dazu beiträgt, dass die Relation Staatsschulden zu BIP in diesem Jahr weit unter die Maastricht-Marke von 60 Prozent sinken wird.
Bei Italien wird das nicht so gut laufen. Ich vermute, dass der reale Leitzins angesichts einer wahrscheinlichen Inflationsrate von 0,5 Prozent etwa -0,5 Prozent betragen dürfte, also unterhalb der Zuwachsrate des realen BIP von 0% . Die langen Realzinsen werden aber bei rund zwei Prozent liegen. Von allein kommt das Land daher nicht aus dem Schneider. Bei der Restriktionspolitik noch mal draufzusatteln kommt aber angesichts der labilen politischen Lage nicht infrage – nur eine Politik, die entschlossen auf Wachstum setzt, kann mittelfristig einen Ausweg bieten. Da müsste die EU-Kommission aber mitspielen.
Insgesamt ist das sogenannte marginale Grenzprodukt des privaten Kapitals in den Industrieländern sehr niedrig, Stichwort „säkulare Stagnation“, was zum Einen die Opportunitätskosten zusätzlicher staatlicher Schulden niedrig hält und zum Anderen tendenziell den Schuldendienst erleichtert. Bei „normalen“ Ländern sind neue Schulden nicht gefährlich, sie können vielmehr dazu beitragen, durch gezielte Verbesserungen des öffentlichen Kapitalstocks die privaten Kapitalrenditen und damit die Investitionen und das Wachstumspotenzial zu steigern.
Und zum Schluss plädiere ich im Übrigen noch einmal dafür, die Wirtschafts- und Währungsunion rasch weiter zu entwickeln, einschließlich einer europäischen Treasury und eines Einstiegs in die Transferunion. Nur dann kann das Risiko ausgeschlossen werden, dass der Euro eines Tages wegen der extremen Unterschiede in der wirtschaftlichen Entwicklung von Zentrum und Peripherie auseinanderfliegt. Eine immer engere Union ist ja nach wie vor das Ziel des europäischen Projekts. Nach dem Ausscheiden der Briten dürfte Manches leichter durchzusetzen sein.