Auf einmal gibt es kein Altersheim Deutschland mehr. Aus dem Dauerpatienten und hoffnungslosen Fall ist eine Konjunkturlokomotive geworden. Ich habe die jüngste Global Economic Outlook Summary der Wallstreet-Firma JPMorgan vor mir, deren bislang äußerst skeptische und aufreizend besserwisserische Analysten für das Jahr 2011 beim realen BIP jetzt eine Zuwachsrate von 3,5 Prozent für Deutschland erwarten. Ich vermute, dass auch andere ihre Prognosen in den kommenden Monaten deutlich nach oben revidieren werden.
Wie das? Im Grunde hat es nichts mit Hexerei zu tun, sondern einfach mit dem glücklichen Umstand, dass die Wirtschaftspolitik, auf’s Ganze gesehen, aus deutscher Sicht zur rechten Zeit genügend expansiv war. Das gilt vor allem für den Wechselkurs und die kurzfristigen Zinsen, die seit 1999 nicht mehr dem Einfluss nationaler Politik unterliegen, sondern von den Entwicklungen in der Währungsunion insgesamt bestimmt werden.
Einige Zahlen zur aktuellen wirtschaftlichen Situation: Das reale BIP lag im vierten Quartal um nicht weniger als 4,0 Prozent über seinem Vorjahreswert. Anders als in allen großen und den meisten kleinen Industrieländern hat die Beschäftigung zudem kräftig zugenommen und übertrifft mittlerweile ihren Vor-Krisen-Rekordwert von Oktober 2008 um 0,8 Prozent, so dass die Arbeitslosenquote auf 7,4 Prozent gefallen ist – Mitte des vergangenen Jahrzehnts hatte sie fast 12 Prozent erreicht.
Das Erfreuliche ist dabei, dass die Investitionen richtig in Fahrt gekommen sind und jetzt zu erwarten ist, dass die Produktivität, von der die Zunahme des allgemeinen Wohlstands entscheidend abhängt, endlich wieder mit ansehnlichen Raten expandiert: Die inländischen Umsätze der Investitionsgüterproduzenten waren im vergangenen Quartal 13,9 Prozent höher als vor Jahresfrist, und zwischen dem dritten und vierten Quartal gab es eine annualisierte Zuwachsrate von nicht weniger als 24,2 Prozent. Ganz ähnlich sieht es bei den realen inländischen Auftragseingängen im Investitionsgütergewerbe aus. Sogar die Einfuhren von Investitionsgütern boomen, trotz des schwachen Euro: Sie lagen in den letzten drei Monaten um 14,6 Prozent über ihrem Vorjahresniveau.
Das heißt im Übrigen auch, dass der Aufschwung eine stabile Grundlage hat und möglicherweise bereits selbsttragend ist. Es hilft, dass es wegen der jahrzehntelangen Investitionsschwäche einen erheblichen Nachholbedarf gibt. Gleichzeitig haben sich die Unternehmensgewinne seit dem konjunkturellen Tiefpunkt im ersten Halbjahr 2009 stark verbessert – schätzungsweise um mindestens plus 30 Prozent. An Eigenmitteln mangelt es nicht.
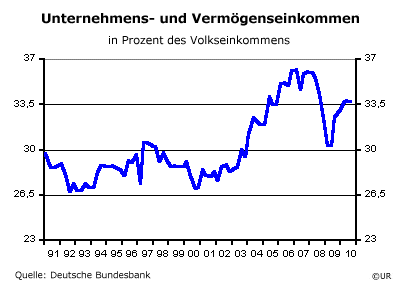
Um das positive Konjunkturbild abzurunden: Die Inflation betrug nach dem breitesten verfügbaren Maß, dem Deflator des Bruttoinlandsprodukts, im vierten Quartal nur 0,3 Prozent (Vorjahresvergleich). Wer will da klagen?
Wie expansiv oder restriktiv die Wirtschaftspolitik wirkt, lässt sich an verschiedenen Indikatoren ablesen. Man kann sie, wenn man möchte, zu einem sogenannten Financial Conditions Index bündeln, wie das beispielsweise Goldman Sachs tut. Aufschlussreicher ist aber im Kontext der Währungsunion der Blick auf jeden einzelnen Indikator. In der Einkommenspolitik und der Finanzpolitik werden die Weichen nach wie vor von inländischen Akteuren gestellt, in der Zins- und Wechselkurspolitik dominiert dagegen die europäische Ebene.
Was den Wechselkurs des Euro angeht, kommt es darauf an, von welchen Faktoren Nachfrage und Angebot vor allem bestimmt werden. Die Leistungsbilanz des Euroraums wies in den vergangenen drei Jahren geringe Defizite auf, in der Größenordnung von 0,5 bis 0,8 Prozent des gemeinsamen BIP (von zur Zeit rund 9300 Mrd. Euro). Von daher gibt es auf den Devisenmärkten ein Überangebot an Euro, was tendenziell seinen Wechselkurs drückt. Das ist in letzter Zeit nicht durch autonome Kapitalimporte überkompensiert worden. Die Ertragschancen galten insgesamt als nicht sonderlich positiv, vor allem im Vergleich zu den Schwellenländern. Im vergangenen Jahr kamen dann noch die Schuldenkrisen in der sogenannten Peripherie des Währungsraums hinzu. Das Schaubild zeigt, wie stark der Euro im Jahr 2010 real abgewertet wurde. „Real“ heißt hier, dass der handelsgewogene Kurs um die Effekte der internationalen Inflationsdifferenzen bereinigt wurde.
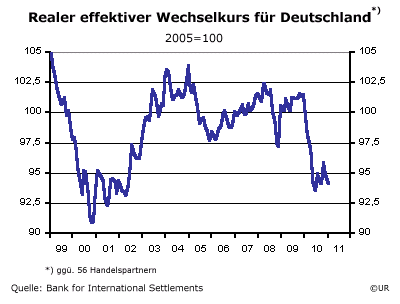
Insgesamt hat sich dadurch aber die Wettbewerbsposition der europäischen Unternehmen sehr verbessert, was wiederum insbesondere in Deutschland einen äußerst positiven Einfluss auf die Konjunktur hatte. Unser Angebot an Waren und Dienstleistungen befriedigt nahezu passgenau die Bedürfnisse der aufstrebenden Länder.
Hätte Deutschland noch die Mark, wäre es angesichts von Leistungsbilanzüberschüssen von mehr als 5 Prozent des BIP sowie der relativ soliden öffentlichen Finanzen zu einer Aufwertung gekommen, die der des Schweizer Franken oder der Schwedenkrone entsprochen hätte. So positiv Aufwertungen langfristig sind, so sehr sind sie kontraproduktiv, wenn sich ein Land von einer tiefen Rezession erholen will. Freuen wir uns, dass es den Euro gibt!
Bei den Zinsen war der expansive Effekt mindestens genauso groß wie beim Wechselkurs. Da die Arbeitslosigkeit im Euroland insgesamt weiterhin zäh um die 10-Prozent-Marke pendelt und die Inflation lange eher unter als über der Zielmarke von etwas unter zwei Prozent lag, das Bankensystem zudem keineswegs als saniert gilt, ist die EZB gezwungen, den Hauptrefinanzierungssatz weiterhin bei ein Prozent zu halten, was wiederum die gesamte Struktur der kurzfristigen Marktzinsen auf einem sehr niedrigen Niveau hält. Real sind die 3-Monatssätze seit Ende 2008 um nicht weniger als drei Prozentpunkte gesunken und befinden sich gegenwärtig im negativen Bereich.
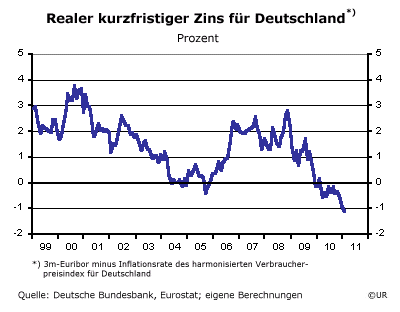
Es lohnt sich für Banken, kurzfristige Mittel aufzunehmen und längerfristig zu verleihen. Wenn das reale BIP beispielsweise mit Raten von drei Prozent, oder auch nur von zwei Prozent expandiert, haben die Kreditnehmer im Allgemeinen keine Probleme mit dem Schuldendienst. Die Banken können außerdem schon allein dadurch gutes Geld verdienen, dass sie Bundesanleihen oder Pfandbriefe durch Kreditaufnahme am Geldmarkt refinanzieren. Dass die Kreditvergabe im Euroraum insgesamt nicht anspringen will, hat vor allem damit zu tun, dass in zahlreichen Ländern, mit Spanien, Irland und Griechenland an der Spitze, weite Teile der Wirtschaft überschuldet sind und die Rückzahlung von Krediten höchste Priorität hat. In Deutschland ist das bekanntlich nicht der Fall – es gab keine Immobilienblase! -, so dass die Medizin der EZB hier jedenfalls jetzt anzuschlagen scheint.
In den erwähnten Financial Conditions Indices spielt die Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinsen, also etwa die zwischen der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen und dem 3-Monats-Euribor, eine Schlüsselrolle. Je positiver die Differenz, desto stärker der expansive Impuls der Geldpolitik. Auch nach diesem Maßstab war sie anti-zyklisch und damit situationsgerecht. Die deutsche Wirtschaft hat sehr von der steilen Zinskurve profitiert, die Länder mit höheren Zinsen am langen Ende des Spektrums allerdings noch viel mehr, angefangen von Griechenland und Irland am oberen Ende bis zu Frankreich, Österreich und Finnland am unteren Ende. Die Geldpolitik hat jedenfalls alles getan, um die Rezession in der Währungsunion zu stimulieren.
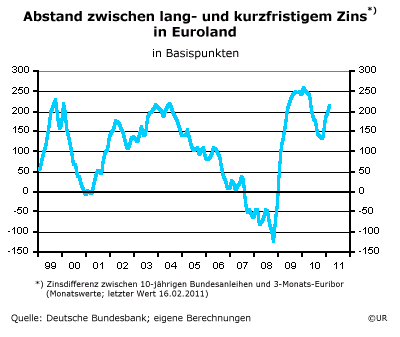
Die deutsche Finanzpolitik war dagegen nicht sonderlich expansiv. Zwar sind die staatlichen Defizite während und unmittelbar nach der Rezession von 2009 (als das reale BIP gegenüber 2008 um 4,7 Prozent gesunken war) stark gestiegen, im Vergleich zu den amerikanischen, britischen, japanischen oder auch französischen und spanischen Defiziten waren sie sehr gering. In keinem entwickelten Industrieland außer Japan war die Rezession so tief wie in Deutschland – gemessen daran, genauer: bereinigt um die konjunkturelle Lage, kann man eher von einer restriktiven Finanzpolitik sprechen. Alle Prognosen deuten darauf hin, dass die deutschen Haushaltsdefizite innerhalb weniger Jahre mehr oder weniger verschwinden werden.
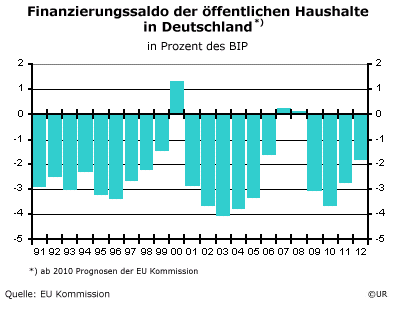
Haushaltsausgleich hat ja inzwischen Verfassungsrang. Angesichts der immer noch gewaltigen deutschen Outputlücke ist das aus konjunktureller Sicht keine optimale Politik. Solange die Lücke fortbesteht, solange kann und sollte der Staat eine expansive Politik verfolgen. Die niedrigen Renditen der Bundesanleihen sind ein Zeichen dafür, dass die Anleger keine Angst vor anziehenden Inflationsraten oder unzumutbaren Lasten für die kommenden Generationen haben. Nach wie vor sollte zudem das Argument nicht vom Tisch gewischt werden, dass auch der Staat für seine Investitionen Schulden aufnehmen darf, wie jedes Unternehmen oder jeder, der sich ein Haus kauft. Wenn investiert wird, wird den Nachfahren ja nicht nur ein Schuldenberg hinterlassen, sondern auch ein größerer Kapitalstock – das schließt im Grunde Investitionen in das Humankapital ein.
Die deutsche Fokussierung auf die Reduzierung der Budgetdefizite hat allerdings, wie ich gerne zugebe, den Vorteil, dass der Staat, und damit der deutsche Steuerzahler, sich langfristige Mittel zu attraktiven Konditionen leihen kann. Das fördert die Investitionen und erhöht auf diese Weise das Wachstumspotential. Für mich ist das aber nur ein Nebeneffekt. Per Saldo ist die deutsche Finanzpolitik jedenfalls seit einigen Quartalen leicht restriktiv.
Das gilt auch für die Lohnpolitik. Das folgende Schaubild zeigt, dass die Effektivlöhne je Beschäftigten inflationsbereinigt seit 1993 (!) praktisch nicht gestiegen sind – insgesamt waren es vom 3. Quartal 1993 bis zum 3. Quartal 2010 nur 0,2 Prozent! Der Durchschnitt, um den es sich hier handelt, verbirgt natürlich, dass es für einzelne Gruppen von Beschäftigten sehr wohl kräftige Einkommensgewinne gab. Dafür haben aber andere starke Einbußen hinnehmen müssen. Die immer intensivere internationale Arbeitsteilung führt dazu, dass es vor allem für einfache Arbeiten eine Art Weltlohn gibt, dessen Höhe von chinesischen und indischen Grenzanbietern bestimmt wird. Besonders betroffen sind Arbeiter in Sektoren, die voll dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, aber über Arbitragemechanismen überträgt sich dieser Effekt auch auf andere, von inländischer Nachfrage dominierte Bereiche, in denen keine anspruchsvollen Qualifikationen nötig sind. Im Vorteil sind die Gruppen von Beschäftigten, die entweder vor internationalem Wettbewerb geschützt sind – zum Beispiel beim Staat -, die in monopolartigen Unternehmen aller Art arbeiten, oder die über herausragende berufliche Qualifikationen verfügen. Es liegt auf der Hand, dass sich vom Markt her die Einkommensunterschiede vergrößern werden. Die Struktur des privaten Konsums dürfte sich entsprechend ändern.
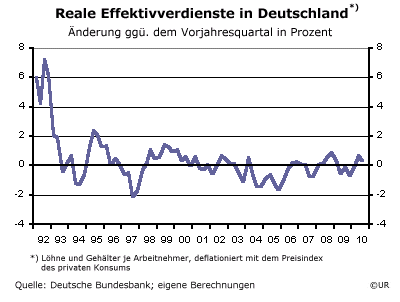
Insgesamt haben die deutschen Löhne nichts zu dem jetzigen Konjunkturaufschwung beigetragen. Allein von der Beschäftigung sind positive Impulse ausgegangen. Es besteht also noch Nachholbedarf, und wenn nicht alle Zeichen trügen, wird es jetzt auch endlich wieder kräftigere Lohnsteigerungen geben. Die Unternehmen können sie leicht verkraften, weil die Produktivität ebenfalls weiter anziehen wird. Erst wenn die Löhne wieder einmal mit Raten von real ein bis zwei Prozent steigen, kann auch der Konsum seinen Beitrag zum Expansionsprozess leisten. Auf ihn entfallen schließlich 62 Prozent der inländischen Nachfrage. Erst wenn sich hier endlich etwas tut, kann man von einem sich selbst tragenden und damit dauerhaften Aufschwung sprechen. Dann würde es auch zu verkraften sein, wenn die EZB allmählich die Zinsen anhebt und der Euro sich aufwertet. Ein solches Szenarium ist fast zu schön, um wahr zu sein.