In Amerika war lange Zeit zu besichtigen, wie Kapitalismus funktioniert. Eine dynamische Wirtschaft, die größten und am besten geführten Unternehmen der Welt, eine Gründerwelle nach der anderen, Aufstiegschancen für alle, der höchste Lebensstandard – kein Superlativ reichte. Auf einmal passiert jedoch etwas, was bislang als typisch für die angeblich überregulierten und zunehmend überalterten Volkswirtschaften Europas und Japans galt, dass nämlich Beschäftigung und Produktivität mit nur äußerst niedrigen Raten zunehmen.
Der Internationale Währungsfonds veranschlagt das mittelfristig mögliche Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts auf zwei Prozent, andere Analysten halten 1,75 Prozent für realistischer. Das ist die Hälfte dessen, was in den neunziger Jahren als normal galt. Bis die nach wie vor sehr große Output-Lücke geschlossen ist, es also Kapazitätsreserven gibt, kann es auch rascher vorangehen, aber dann – dann sind es eben nur noch 1,75 Prozent. Die USA sind dabei, ihren Sonderstatus zu verlieren. Vielleicht haben sie ihn sogar bereits verloren.
Im aktuellen Economist befassen sich der Leitartikel und ein Sonderkapitel mit genau diesem Thema (America’s lost oomph und Jobs are not enough). Noch nie in der Nachkriegszeit war der Aufschwung nach einer Rezession so schwach wie diesmal. Und wenn es danach mit den neuen mickrigen Zuwachsraten weitergeht, muss sich das Land darauf einstellen, dass sich der Lebensstandard nur langsam weiter verbessern wird, dass die Steuereinnahmen hinter den langfristigen Budgetplanungen zurückbleiben und dass der Schuldendienst auf viele Jahre hinaus eine schwere Bürde bleiben wird. Für den Economist wird das amerikanische Wachstumsmodell von zwei Seiten attackiert: Das Arbeitskräftepotenzial nimmt viel langsamer zu als früher, und aus unerfindlichen Gründen ist die Produktivität ins Stocken geraten, trotz der vielen Innovationen, über die täglich berichtet wird. Es lässt sich nicht mehr leugnen, auch in den USA ist die Luft raus.
In den Nachkriegsjahren stiegen die Produktivität und damit der Wohlstand in Japan und Deutschland deutlich rascher als in den USA, Mitte der neunziger Jahre, als der Aufholprozess abgeschlossen war, waren sich die Raten dann sehr ähnlich – sie lagen im Zehnjahresdurchschnitt etwa bei zwei Prozent (was sich in dem folgenden Schaubild an den Datenpunkten für 1997 ablesen lässt). Danach, im Verlauf des Clinton-Booms, übertrafen die amerikanischen die der beiden anderen Länder deutlich. Wie sich inzwischen herausstellt, war das nicht von Dauer. Mittlerweile konvergieren die Zuwachsraten in allen drei Volkswirtschaften bei Werten um ein Prozent.
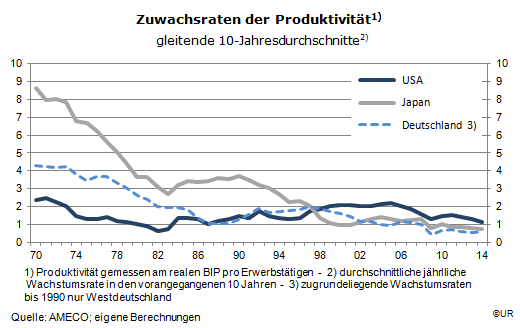
Vor allem aus zwei Gründen kam es in den USA zu diesem Rückgang: Je kapitalreicher ein Land ist, desto geringer fällt der Zuwachs an Output bei einem zusätzlichen Einsatz von Sachkapital und Software aus. Es handelt sich hier um das „Gesetz vom abnehmenden Grenzertrag des Kapitals“. Ein fiktives Beispiel: Die erste Autobahn von Boston nach Washington ermöglicht durch Mauteinnahmen eine Verzinsung des eingesetzten Kapitals von, sagen wir, 30 Prozent, die zweite dann nur noch einen von 10 Prozent. Der erste Traktor löst auf den Feldern eine Revolution aus, der zweite verwaltet sie. You know what I mean.
Grund Nummer zwei ist der Rückgang der volkswirtschaftlichen Investitionsquote: Wenn die Ertragserwartungen sinken – weil schon so viel an Kapital vorhanden ist, wird weniger investiert. Die sogenannte Kapitalintensität geht zurück. Das macht sich seit einiger Zeit auch in den USA bemerkbar, obwohl es nicht so dramatisch war wie in den vergangenen zwei Jahrzehnten in Japan.
Am beunruhigendsten ist allerdings der anhaltende Rückgang der Investitionsquote in Deutschland, denn wo nicht investiert wird, kann es auch nicht zu Wachstum kommen. Wenn der Anteil der Alten an der Bevölkerung so stetig steigt wie bei uns, kann die Last, die die Jüngeren für die Nicht-Aktiven zu schultern haben, allein durch einen rascheren Fortschritt bei der Effizienz der Arbeit abgemildert werden, und das erfordert mehr Aufwendungen für Kapitalgüter. Es geht leider in die entgegengesetzte Richtung.
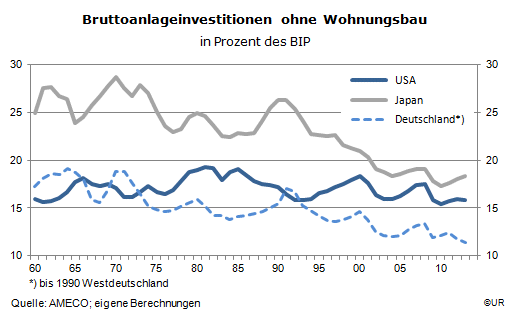
Die amerikanischen Unternehmen, denen es ja insgesamt nicht schlecht geht, verlagern offenbar seit Langem ihre Investitionen immer mehr ins kapitalarme Ausland, wo sich höhere Renditen erzielen lassen, ähnlich wie die deutschen und japanischen das machen. Sie bilden dort Eigentum, was wiederum Einkommen für die inländischen Eigentümer dieser Unternehmen generiert. Nicht allein die inländischen Arbeitnehmer müssen daher für die Rentner schaffen, zunehmend sind es die Ausländer. Es geht aber zulasten des inländischen Kapitalstocks.
Dazu eine eindrucksvolle Zahl aus Deutschland: Die Erwerbs- und Vermögenseinkommen aus dem Ausland haben inzwischen etwa 80 Mrd. Euro pro Jahr erreicht, 3,7 Prozent des Volkseinkommens, Tendenz stark steigend. Die Schweiz macht seit Jahrzehnten vor, wie man gut von seinem Auslandsvermögen leben kann.
Noch etwas Anderes bremst das Wachstum des realen BIP in den USA: die inzwischen sehr geringe Zuwachsrate der Beschäftigung. In den vergangenen zehn Jahren ist sie auf 0,5 Prozent jährlich zurückgegangen, auf ein Viertel dessen, was in den Jahrzehnten bis Anfang der neunziger Jahre üblich war. Auch die amerikanischen Arbeitnehmer sind in dieser zunehmend globalisierten Welt der Konkurrenz ausländischer Arbeitnehmer ausgesetzt. Freihandel führt dazu, dass sich für eine breite Palette an Tätigkeiten ein einheitlicher globaler Arbeitsmarkt bildet.
Wenn Amerikaner, die für Firmen arbeiten, die im internationalen Wettbewerb stehen, nicht bereit sind, bei ihren Löhnen Abstriche zu machen, verlieren sie ihren Job. Die Unternehmen sind immer auf dem Sprung ins Ausland, wo die Märkte für ihre Produkte sind, und wo für das Personal nicht so viel zu zahlen ist. Hinzu kommt, dass es seit Nine Eleven nicht mehr so leicht ist, in die USA einzuwandern – dadurch, und weil die Baby Boomer jetzt ins Rentenalter kommen, nimmt das Angebot an Arbeit nur noch langsam zu.
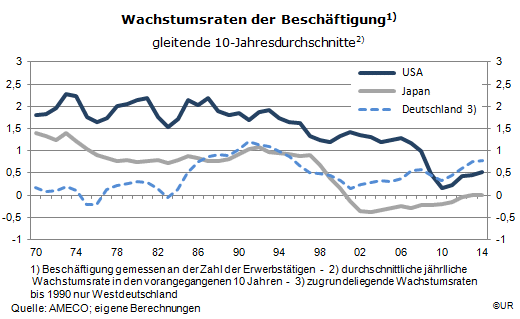
Am krassesten sind die Beschäftigungsprobleme allerdings in Japan: Die Gesellschaft altert rasch und Einwanderer sind nicht erwünscht. Glücklicherweise ist das in Deutschland inzwischen nicht mehr der Fall. Das Diktum – einst auch das der Gewerkschaften –, dass die Einwanderer den Einheimischen die Jobs wegnehmen, gilt nicht mehr. Wir sind ein Einwanderungsland geworden und haben die Integration der Immigranten bisher einigermaßen gut hinbekommen. Was will man mehr? In den vergangenen zehn Jahren gab es jährlich rund 0,8 Prozent mehr Jobs, während gleichzeitig die Arbeitslosenquote stetig zurückging. Mit Fremdenfeindlichkeit lassen sich glücklicherweise keine Wahlen mehr gewinnen.
Am Ende dieser tour d’horizon geht es um die Zuwachsraten des realen BIP, als Produkt von Produktivität und Beschäftigung.
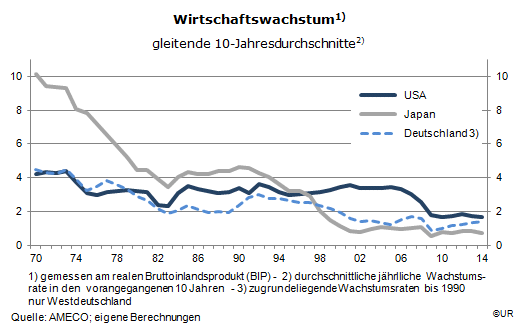
Es ist frappierend, wie ähnlich sich die drei Volkswirtschaften in den vergangenen zehn Jahren geworden sind. In allen hat sich das Wachstum im Laufe der Jahrzehnte stark verlangsamt, am wenigsten in Japan – da war es schon vorher sehr niedrig – und liegt jetzt zwischen 0,8 und 1,8 Prozent. Das könnte die neue normale Wachstumsdynamik sein, also das, auf was wir uns in der Zukunft einstellen müssen, es sei denn, es gelingt wieder, die Investitionsquoten hochzuschrauben und die Qualifikation der aktuellen und potenziellen Beschäftigten zu verbessern. An einem lässt sich so schnell nichts ändern: dass es in den Jahren bis zur Finanzkrise zu massiven Fehlinvestitionen im Immobilienbereich (außer in Deutschland) und im Finanzsektor gekommen ist, die jetzt korrigiert werden. Für eine Weile dürfte das Schrumpfen dieser Sektoren noch zulasten des gesamtwirtschaftlichen Wachstums gehen.