Öffentliche Defizite abzubauen ist Gift für die Konjunktur, solange es in der Wirtschaft gewaltige ungenutzte Reserven gibt. In der europäischen Währungsunion ist das der Fall: Die Arbeitslosenquote liegt bei 11,5 Prozent, und die Kapazitätsauslastung ist nach meiner Rechnung rund 13 Prozent niedriger als sie sein könnte. Niemand darf sich wundern, dass eine solche prozyklische Politik die Lage verschlimmert und das Risiko einer neuen Rezession zunimmt. Stagnation, abgelöst von Rezessionen ist inzwischen der Normalzustand geworden. Da hilft auch die expansive Geldpolitik nur begrenzt. Wer braucht noch den Euro, wenn die wirtschaftlichen Erfolge ausbleiben?
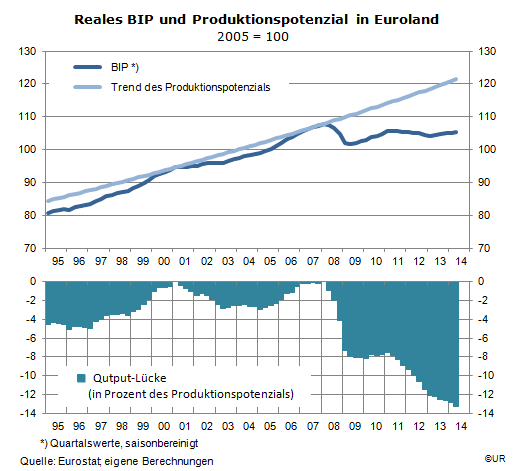
Eurostat hatte am Dienstag die aggregierten Haushaltszahlen für 2010 bis 2013 veröffentlicht. Danach ist die Währungsunion als Ganzes finanzpolitisch auf dem Pfad der Tugend, jedenfalls soweit die Maastrichter Kriterien der Maßstab dafür sind: Das Defizit des Staates hat sich nicht nur absolut Jahr für Jahr verringert, auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt ist es stark zurückgegangen, von 6,1 Prozent im Jahr 2010 auf zuletzt 2,9 Prozent. Drei Prozent ist bekanntlich die Obergrenze. Da der Schuldenstand des Staates aber nur 60 Prozent des BIP betragen darf und er leider aber immer noch bei 90,9 Prozent liegt, ist damit zu rechnen, dass die restriktive Finanzpolitik fortgesetzt wird und sich die Regierungen Eurolands de facto kaputtsparen. Wann kehrt endlich die Einsicht ein, dass es so nicht weitergehen darf?
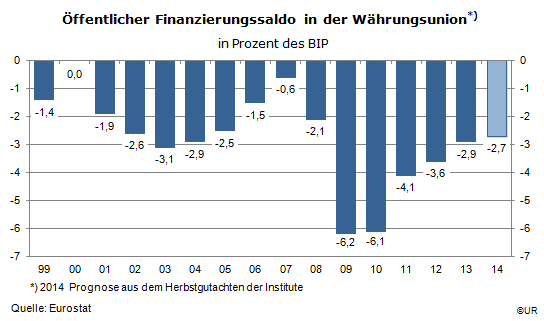
Zurzeit werden die Prognosen für das BIP Eurolands, aber auch Deutschlands, wieder einmal nach unten revidiert. Nach zwei Rezessionsjahren soll laut Prognose der Institute 2014 für die Währungsunion eine Wachstumsrate von 0,8 Prozent herauskommen. Normalerweise gibt es nach einem Einbruch der Konjunktur sehr hohe Zuwachsraten – davon kann diesmal nicht die Rede sein; selbst für 2015 wird nur ein mickriger Zuwachs von 1,1 Prozent erwartet. Dafür soll der Finanzierungssaldo der öffentlichen Haushalte stetig weiter vermindert werden und 2015 nur noch 2,5 Prozent des BIP betragen. Kein Analyst scheint ernsthaft zu erwarten, dass die prozyklische Finanzpolitik aufgegeben wird.
Im Vergleich dazu sind die Meldungen über die Konjunktur in den USA und Großbritannien geradezu euphorisch. Kaum jemand nimmt Anstoß daran, dass die staatlichen Defizite dort viel höher sind als im Euroraum. Laut IWF betrugen sie 2013 jeweils nicht weniger als 5,8 Prozent des BIP und dürften 2014 immer noch bei 5,5 Prozent liegen. Da die Beschäftigung zügig zunimmt, das reale BIP mit Raten zwischen 2,5 und drei Prozent expandiert und die Inflation unter Kontrolle ist, werden die staatlichen Budgetdefizite und rekordhohen Schulden nicht als Probleme wahrgenommen. Niedrige Schulden sind im wirtschaftspolitischen Zielekanon der beiden angelsächsischen Länder nur auf den hinteren Plätzen zu finden.
Der springende Punkt ist, dass niemand damit rechnet, dass die US Treasury oder das britische Schatzamt eines Tages nicht mehr in der Lage sein könnten, ihre Schulden zu bedienen. Da sie Zugang zu den Druckerpressen ihrer Notenbanken haben und die Schulden fast komplett auf die eigene Währung lauten, können immer genügend Dollar und Pfund generiert und an die Gläubiger überwiesen werden. Im Euroraum geht das nicht. Herr Schäuble oder Monsieur Sapin können die EZB nicht so einfach beauftragen, ihnen gegen aus dem Hut gezauberte Schuldscheine die Euros gutzuschreiben, die sie für die Bedienung ihrer Staatsschulden benötigen. In dieser Hinsicht sind ihre Euroschulden Fremdwährungsschulden, mit der Folge, dass für europäische Finanzminister budgetpolitische Disziplin das einzige Mittel ist, mit dem sie die Käufer der Staatsschulden davon überzeugen können, dass sie künftig in der Lage sein werden, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen. Im Vergleich zu Ländern, die Notenpressen im Keller stehen haben, sind sie klar benachteiligt. Statt Geld zu drucken, müssen sie – oder jedenfalls die meisten europäischen Finanzminister – Rezessionen veranstalten und den Lebensstandard ihrer Mitbürger einschränken.
Gibt es einen Ausweg? Ja, natürlich. Er heißt Eurobonds. Wie im Einzelnen sie auszugestalten wären, muss diskutiert werden. Einige Vorschläge liegen seit Jahren auf dem Tisch. Bekanntlich geht es bei ihnen vor allem um die Frage, wie unsichere Kantonisten aus den lateinischen Ländern und dem Osten davon abgehalten werden können, ihre Strukturreformen und ihre Sparpolitik in dem Augenblick aufzugeben, in dem sie ohne Bedingungen an billiges Geld von einer gemeinsamen europäischen Institution kommen. Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) könnte diese Rolle eines möglichst nicht so fernen Tages ausfüllen. Er würde gegenüber den Kapitalanlegern aus dem Inland (Eurolands) und dem Rest der Welt als einziger Emittent von Staatspapieren auftreten, dafür aber im Innenverhältnis haushaltspolitische Disziplin einfordern. Der ESM wäre gewissermaßen das europäische Schatzamt, das sich mit der EZB darüber verständigen könnte, wie viel Geld zu drucken ist. Er hätte also Zugang zu einer Notenpresse und damit niemals Probleme mit dem Schuldendienst.
In der Bilanz des ESM, des neuen europäischen Schatzamts, würden auf der Aktivseite vor allem Forderungen gegenüber den 18 Teilstaaten der Währungsunion stehen. Sie würden nicht alle mit denselben Sätzen verzinst – eine Differenzierung wird auf Jahrzehnte hinaus erforderlich bleiben. In der jetzigen Situation kommt es allerdings darauf an, dass die haushaltspolitischen Auflagen nicht zu streng sind. Es geht ja darum, die unheilvolle prozyklische Finanzpolitik so lange auszusetzen, bis sich die europäische Wirtschaft wieder in einem selbsttragenden Aufschwung befindet.