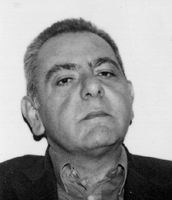Ich habe mit Hazem Saghiehs Einverständnis folgenden Text für unsere morgige Print-Ausgabe übersetzt. Dort wird er mit leichten Kürzungen erscheinen.
Hazem Saghieh wurde 1951 im Libanon geboren. Er ist Meinungsredakteur von Al-Hayat, der zweitgrößten pan-arabischen Tageszeitung mit Sitz in London. 1997 erschien sein Buch „Eine Verteidigung des Friedens“ (arabisch). Hier eine (etwas wirre, aber informative) Magisterarbeit über seine Position in der arabischen Debatte.
Besser wir Araber gestehen unsere Niederlage ein, als dass wir so weitermachen wie bisher. Keiner der vier arabisch-israelischen Kriege – 1948, 1967, 1973 und 1982 – konnte uns davon überzeugen, dass wir verloren hatten. Gaza wird von einer Mischung aus Mafia und Taliban regiert, der Irak ist zerstört, der Libanon am Abgrund. Eine Welle des Fanatismus bedroht unsere Länder, Blutvergiessen ist der Alltag, die Freiheit der Frau wird beschnitten, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung befinden sich im Verfall. Was fehlt eigentlich noch, um uns zum Eingeständnis der Niederlage und zu einem Geisteswandel zu drängen?
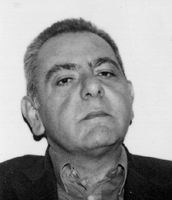
Hazem Saghieh
Mancher verweist auf die amerikanische und israelische Politik, die kaum je verhandlungsbereite und selbstkritische Positionen auf arabischer Seite gefördert hat. Wohl wahr: Diese Politik war oft so brutal, eigennützig oder einfach dumm, dass sie ohnehin schon feindselige Haltungen unter den Arabern nur verstärken konnten.
Aber dieses Argument droht den Kern der Sache zu verschleiern. Die gegenwärtige Lage im Nahen Osten ist das Ergebnis einer Kulturkrise, die man nicht sieht, wenn man die Lage nur von einem politischen Standpunkt aus betrachtet.
Es gehört mit ins Bild, dass die meisten arabischen Intellektuellen immer noch jede Normalisierung mit dem »zionistischen Feind« ablehnen und die fundamentalistischen Bewegungen immer weiter wachsen. Ägypten hat zwar 1978 die Camp-David-Vereinbarungen mit Israel unterschrieben, ist aber seither keinen Zentimeter von der Position des »kalten Friedens« mit dem Nachbarn abgerückt. Libanon hängt weiter der Rhetorik des »Widerstands« an, obwohl die israelischen Truppen schon vor 7 Jahren abgezogen wurden. Und im Falle Syriens bleibt zweifelhaft, ob das Regime seine quasi-imperialistische Rolle in der Region aufgeben wird, um den Golan zurückzubekommen.
Es ist kein Zufall, dass unser arabischer »Widerstand« immer nur Chaos und Fragmentierung produziert – im Irak, in Palästina und im Libanon. Man kann eben keinen »nationalen Befreiungskrieg« führen, wenn man keine Nation ist. Wir haben vorstaatliche Formationen (Sekten, Stämme, Ethnien), die mit poststaatlichen Ideologien hantieren (Panarabismus, Panislamismus). Das ist ein Rezept für ewige gegenseitige Rachefeldzüge.
Der tiefere Grund für die heutige Misere vom Irak über Libanon bis nach Gaza liegt hier: Die arabischen Gesellschaften haben es nicht geschafft, eine moderne säkulare Legitimationsbasis für ihre Staaten zu entwickeln. Sie blieben beim Islam oder bei tribalen Loyalitäten als Quellen der Legitimität stehen. Der Nationalstaat hat im arabischen Boden nie tiefe Wurzeln schlagen können. Die vielen konkurrierenden Identitäten – man ist gleichzeitig Muslim, Araber, Bürger eines Landes und Mitglied einer religiösen und ethnischen Gruppe – führen dazu, den politischen Bereich unter Druck von seiten lauter nichtpolitischer Faktoren zu setzen. Eine säkulare, ausdifferenzierte, rationale Politik kann so nicht funktionieren.
Unsere Bereitschaft, despotische Regime zu akzeptieren, bloss weil sie behaupten, gegen »Imperialismus und Zionismus« zu stehen, ist extrem bezeichnend. Überall im Nahen Osten sind Menschen bereit, erschreckend rückständige und fanatische Bewegungen auf der Basis zu verteidigen, sie seien ein Produkt des »Widerstands«. Sie weigern sich, etwa die iranische Einflußnahme in arabische Angelegenheiten – durch die Unterstützung der Hamas – zu kritisieren, obwohl sie wissen, das dieser »Anti-Imperialismus« nichts bringt und brutale Rückschläge heraufbeschwört. Wir neigen dazu, Siege auszurufen, wo es sich um das Gegenteil handelt. Diese chronische Sucht nach Triumphen konnte man zuletzt im Konflikt zwischen Israel und Hisbollah am Werk sehen. Hisbollah erklärte einen »göttlichen Sieg«, obwohl der Libanon, mein Heimatland, verwüstet worden war.
Ja, es ist wahr: Die Denkmäler amerikanischer und israelischer Brutalität erstrecken sich von Abu Ghraib nach Guantanamo Bay, über das Flüchtlingslager Dschenin in der Westbank und Qana im Südlibanon. Diese Grausamkeiten verstärken die Argumente derjenigen in der arabischen und muslimischen Welt, die den Konflikt verlängern wollen, sie werden benutzt, um diktatorische Regimes zu legitimieren, und sie nützen den Interessen des militärischen Establishments.
Dennoch: Wir müssen aufhören, unsere selbst bereitete Niederlage zu verleugnen. Je eher alle Teile der arabischen Gesellschaften der Wahrheit ins Gesicht sehen, um so eher werden wir unsere Qual und unsere Demütigung überwinden.
Der lauter werdende Chor derjenigen, die unsere Lage allein als Produkt amerikanischer und israelischer Politik sehen, ist selbst ein Anlass, unsere Niederlage offen einzugestehen. Wir Araber verdammen die Vereinigten Staaten wegen ihrer bedingungslosen Allianz mit Israel seit 1967. Zugleich beschweren wir uns, die USA seien »unfair« in ihrer Haltung zum arabisch-israelischen Konflikt – als ob man von einem Gegner etwas anderes erwarten könnte.
Dieser Widerspruch zeigt eine dahinter liegende Verwirrung im arabischen Verständnis der modernen Welt. Es ist, als würden wir Araber unseren Gegner bekämpfen, um ihn gerechter zu machen – wie ein Kind, das alles kaputtmacht, was es in seine Hände bekommt, um die Aufmerksamkeit seiner hartherzigen Eltern auf sich zu ziehen. Doch wenn das Kind nichts mehr zum kaptuttmachen hat, nehmen die Eltern keine Notiz mehr von ihm.
Die arabischen intellektuellen tragen eine besondere Verantwortung, weil sie dieses Verhalten jahrzehntelang entschuldigt haben. Sie haben Despotismus und Bürgerkrieg so lange gerechtfertigt, wie sie glaubten, dass es ihrer Agenda nütze.
So kann es einfach nicht mehr weitergehen. Wir werden morgen nicht auf einem Bett aus Rosen aufwachen. Wahrscheinlich wird die Lage sich noch lange weiter verschlechtern. Ein Grund mehr, endlich mit einer realistischen Selbsterforschung zu beginnen.