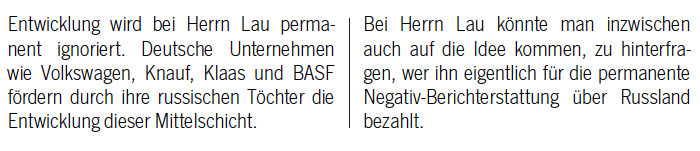Letzte Woche war Sadiq Jalal al-Azm in Berlin bei einem Kongress der Ebert-Stiftung. Ich hatte ihn seit Jahren schon sehen wollen. Nun gab der Krieg in Syrien seiner Rede einen besonderen Hintergrund.
Al-Azm ist vielleicht der wichtigste lebende Vordenker der arabischen Liberalen, ein Aufklärer und Streiter gegen autoritäre Herrschaft und gegen die arabische Selbstviktimisierung. Der Sohn einer syrischen Bürgerfamilie, der den „Damaszener Frühling“ von 2000 mit begründete, lebt heute in Beirut. Wie würde er die Rolle des politischen Islams angesichts der jüngsten Ereignisse in der arabischen Welt, und angesichts des Krieges in Syrien beschreiben? Ich gebe im folgenden meine Notizen wieder.
Er begann mit dem Rückgriff auf die Ereignisse seit dem Januar 2011 in Tunesien und Ägypten. Die Revolte bedeutete die Rückkehr der Politik zu den Menschen, und zugleich die der Menschen zur Politik. Denn unter den autoritären Herrschern hatte es keine wirkliche Politik geben können. Die Macht wurde durch die Revolte „aus den Händen der Söhne“ gerissen. Es sollte keine Vererbung der Herrschaft mehr geben, es ging um die Rückkehr des öffentlichen Lebens zum Volk.
Die perfektionierte Unterdrückung in Syrien durch das Sicherheitssytem Assads machte es unmöglich, den Weg der anderen arabischen Länder zur Selbstbefreiung zu gehen.
Aber durch den „Damaszener Frühling“ von 2000-2001, so al-Azm, „haben wir eine Vorbildrolle gespielt, unsere kritischen reformerischen Ideen waren einer der Samen des Wandels“. (Al-Azm war Erstunterzeichner der „Erklärung der 99“ und der „Erklärung der 1000“, in denen syrische Intellektuelle Demokratie und Rechtsstaatlichkeit forderten.)
Aber erst auf dem Tahrir-Platz konnte die arabische Öffentlichkeit die Erfahrung machen, dass wir „nicht mehr einen Führer brauchen, dass die Massen es alleine schaffen können“, die Herrschaft der Autokraten zu stürzen.
Anfangs gab es eine intensive Beteiligung von Frauen am Protest, und es gab keine sexuelle Belästigung, die sonst den Alltag in Kairo vergiftet. In einem kreativen, karnevalistischen Klima stürzte das Regime. Christen waren auch mit dabei, und sie zeigten ihre Kreuze, während daneben muslimische Prediger zum Gebet riefen.
All das wurde angefeuert von den Neuen Medien, die nicht kontrolliert werden konnten vom Geheimdienstsystem.
In Syrien aber war eine solche Entwicklung nicht möglich, weil das Regime mit aller Härte auf die ersten Demonstrationen reagierte.
Es ist irreführend, von einem „Bürgerkrieg“ in Syrien zu sprechen, anders als seinerzeit im Libanon, wo der Begriff treffend war.
In Syrien stehen nicht Kurden gegen Christen, Drusen gegen Sunniten, Sunniten gegen Ismailiten. Dort stand von Beginn an das Regime gegen die Bürger, die sich nicht mehr bevormunden lassen wollen.
Der Extremismus des Assad-Regimes ist unvergleichbar mit der Reaktion der anderen betroffenen autoritären Herrscher der Region. Und die Revolution reagiert darauf ihrerseits extrem.
Es ist wichtig, die Rechte der Minderheiten im Blick zu behalten. Aber im syrischen Fall sind es vornehmlich die Städte, Viertel und Dörfer der sunnitisch geprägten Mehrheit, die beschossen und zerstört werden.
Man tut den sunnitischen Syrern Unrecht, wenn man ihnen unterstellt, sie würden im Zuge der Revolte die Minderheit entrechten.
Syrien droht geopfert zu werden auf dem Altar der Geopolitik. Große Mächte wie Russland und Iran, Saudi-Arabien und Katar spielen ihre Machtspiele. Die arabischen Linken sind ein Teil davon, wenn sie die Rhetorik des „Arabischen Herbstes“ oder „Winters“ übernehmen, der angeblich den „Frühling“ abgelöst habe. Das verzerrt die Wahrheit über die syrische Revolution.
Die Islamisten wollen heute die Gelegenheit nutzen, die Oberhand zu erlangen.
Der politische Islam ist eine entscheidende mobilisierende Kraft. Man muss ihn als politische Ideologie unterscheiden von einer normalen religiösen Praxis.
Es gibt heute eine Mehrzahl von Strömungen, zwischen denen ein Ringen um Deutungshoheit entbrannt ist. Drei Kräfte sind grob zu unterscheiden. Da ist „der Islamismus der Petrodollars“ aus dem Iran und den Golf-Staaten.
Zweitens gibt es die Dschihadisten ohne eigenen Staat (wenn auch mit Unterstützung aus Ölstaaten).
Das ist der Islamismus, der die einst Kaaba besetzt hielt und Saddat ermordete, und der für den 11. September verantwortlich ist. Es predigt einen „nihilistischen Islam“, einen „Islam der Exkommunikation und Explosion“. Von ihm zu unterscheiden, wenngleich auch gewalttätig, ist der Islamismus von Hisbollah und Hamas, in dem Restbestände der (früher säkularen) nationalen Befreiungsbewegungen enthalten sind. Doch haben beide Bewegungen auf der Grundlage ihres Konfessionalismus (schiitisch die Hisbollah, sunnitisch die Hamas) das Motiv der Befreiung ad absurdum geführt.
Drittens gibt es einen politisierten Islam der Mittelklasse, des Basars, der Banken, der Bourgeoisie. Einen Islam der Zivilgesellschaft, der konservativ, aber gemäßigt ist. Er will sozialen Frieden und Stabilität für die Geschäfte der aufsteigenden Klassen. Dieser Islam gibt Grund zu Optimismus, weil er „Exkommunikation und Explosion“ ablehnt. Am deutlichsten sichtbar ist seine Wirkunsgform bisher vor allem in der Türkei, in Form der AKP. Der Verzicht dieser Partei, die frühere islamistische Formationen beerbt, auf zentrale Elemente der Ideologie – keine Wiedererrichtung des Kalifats, keine Schariaherrschaft – ist etwas Neues.
Ob das türkische Modell sich auch in Tunesien durchsetzen wird, unter Führung von Raschid Ghannouchi, wird interessant zu beobachten sein.
Was wir derzeit erleben, ist der Kampf zwischen den drei Linien des politischen Islams. Für die Muslimbrüder wird es entscheidend sein, wie sie sich mit den beiden anderen Islamismen – dem Islam der Petrodollars und dem von „Explosion und Exkommunikation“ auseinandersetzen.
Al-Azms Heimat Syrien, sagte er in Berlin, werde nicht islamistisch. Nach einer Phase des Chaos, ist er sich sicher, werden sich „bei uns die Moderaten durchsetzen“. Der Business-Islam der Bourgeoisie wird sich gegen Dschihadisten und Petro-Islam durchsetzen: „In Syrien hat ein Islam, der Schulen und Universitäten schließt und Frauen die Arbeit verbietet keine Chance.“
Der Moderator schloß mit den Worten an: „Ihr Wort in Gottes Ohr, verehrter Professor.“