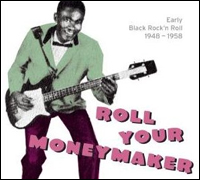Der Rock’n’Roll ist ein Bastard, der viele Eltern hat. Die Kompilation „Roll Your Moneymaker“ stellt sie vor, die frühen Stars der klanggewordenen Brunft
Ach, die Legende. Die erste Rock’n’Roll-Single, heißt es, sei Rocket 88 von Ike Turner gewesen, im Jahr 1951 erschienen (aus Vertragsgründen unter anderem Namen). Dabei hatten bereits während des Zweiten Weltkriegs kleine Labels ihre Chance gewittert: Der Markt stagnierte, die schon älteren weißen Geschäftsleute an den Rudern der Plattenfirmen steuerten einen sicheren Kurs mitten im seichten Strom. Unabhängige Produzenten gründelten derweil in sumpfigen Untiefen und stürmischen Strudelzonen, mischten elektrische Gitarren und Saxofone in traditionelle Ensembles, verstärkten die Schlagzeuge oder ließen Klänge durch Abflussrohre laufen, um Echoeffekte zu erzeugen. Sun Records, Chess, King, Specialty und Okeh hießen die Labels. Ihr Publikum war, mehrheitlich jedenfalls, schwarz.
Der frühe Rock’n’Roll – die Petticoats und bonbonlackierte Straßenkreuzer der Sechziger lassen es immer wieder vergessen – wurzelte tief in der afroamerikanischen Kultur, in der mündlichen Überlieferung einer just aus der Sklaverei befreiten Volksgruppe – mit anspielungsreichen, zotigen Texten, körperbetonten Tänzen und handfesten Rhythmen. Den Weißen sei diese Musik zu bedrohlich gewesen, zu sexuell, führt Jonathan Fischer im Büchlein zu Roll Your Moneymaker aus. Fischer ist Boxer, DJ, Maler und Musikjournalist, er kuratiert die Black-Music-Reihe beim Label Trikont. Auf Roll Your Moneymaker stellt er nun frühen schwarzen Rock’n’Roll der Jahre 1948 bis 1958 vor.
Franz Dobler schrieb einmal über Fischer, „immer kommen die Journalisten, die seine gut recherchierten langen Booklet-Texte plündern und seinen Namen nur erwähnen, wenn sie extrem gute Laune haben.“ Der Begleittext ist auch diesmal durchaus fundiert. Es sei kein Wunder, schreibt Fischer, dass ausgerechnet die vollschlanken Herren Fats Domino und Big Joe Turner oder die verschmusten Platters als erste schwarze Musiker beim weißen Publikum ankamen – Typen, die so gar keine sexuelle Bedrohung ausstrahlten. Sie ebneten „weißen Plattfüßen“ wie Bill Haley den Weg. Für das bleichgesichtige Publikum hüllten Produzenten die rumpeligen Rhythmen in Zuckerwatte, in süßliche Doo-Wop-Vokalisen und romantesken Streicherguss. Erst Elvis „das Becken“ Presley bewegte die Hüften so, wie es zu einer Musik passt, die ihren Namen von einem umgangssprachlichen Wort für lustvollen Beischlaf bekam.
In den Liedern, die Fischer zusammengestellt hat, spielen brünstiges Röhren und spelunkige Gewaltfantasien noch die Hauptrollen, stehlen R’n’B-Shouter und Country-Hinterwäldler sich gegenseitig die Melodien und mischen Sonntagmorgengospel hinein. Der Rock’n’Roll war ein Bastard, der viele Eltern hatte, schwarze und weiße, Delta Blues und Zydeco, Schlager und Country. Zu hören ist das etwa bei Ike Turner: Seine Rhythm Kings experimentierten schon seit den vierziger Jahren mit zentnerschweren Bassläufen zu düsteren Texten und rohen Rhythmen. Oder bei Howlin‘ Wolf, der sich von Country-Jodlern ebenso inspirieren ließ wie vom Blueskönig mit der Mundharmonika, Sonny Boy Williamson. Oder bei Rufus Thomas, der seit den dreißiger Jahren in Minstrel-Shows auftrat und noch bis kurz vor seinem Tod im Jahr 2001 mit Tiger-Höschen, Plateaustiefeln und Umhang tourte. Mit Tiger Man (King Of The Jungle) verdreht er den Rassisten das böse Wort von der Dschungelmusik im Maul.
Fischer erzählt dazu im Begleitheft die spannenden Geschichten der Musiker. Etwa die des schwungvoll bluesenden Gitarristen Magic Sam, der so schnell lebte, dass er mit 32 Jahren am Herzinfarkt starb. Kenntnisreich erläutert Fischer, wie Chuck Berry die Grenze zwischen Schwarz und Weiß durchbrach: mit Texten aus der Welt der Halbwüchsigen, der realen wie der lüstern fantasierten. Er stellt Johnny „Guitar“ Watson vor, dessen Space Guitar Jimi Hendrix inspirierte, und Otis Rush, von dem Eric Clapton und Peter Green, Jeff Beck und Carlos Santana sich das Handwerk abschauten. Big Maybelle kommt zu Wort, die nicht nur die Heroinsucht mit Billie Holiday gemein hatte, und Janis Joplins Vorbild Etta James.
Die 24 Aufnahmen – je zwischen 123 und 169 vinylsingletaugliche Sekunden lang – machen die These vom Bastard Rock’n’Roll nachvollziehbar und klingen nicht immer so, wie man es landläufig vom Genre erwartet. Die Zusammenstellung erscheint getrieben vom Impetus des Jägers, Sammlers und Liebhabers – „dann könnte man noch…, und Slim Harpo fehlt… Und Bo Diddley muss auch drauf…“ – der mit seinen schwarzen Lederklamotten und den pelzverzierten Gitarren, der testosterontrunkenen Lautstärke, den Verzerrungsorgien und der knalligen Lichtshow weit hinauswies über den klassischen Rock’n’Roll bis in die Zeiten von Led Zeppelin oder gar den White Stripes. Ja, auch das erwähnt Jonathan Fischer in seinem Text, dessen Quanti- wie Qualität eine ebenso wohllaunige Würdigung verdient wie das auf Roll Your Moneymaker zu Hörende.
Die Kompilation „Roll Your Moneymaker – Early Black Rock’n’Roll 1948-1958“ ist auf CD und Doppel-LP bei Trikont/Indigo erschienen.
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK’N’ROLL
Kitty, Daisy & Lewis: „s/t“ (Sunday Best/Rough Trade 2008)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik