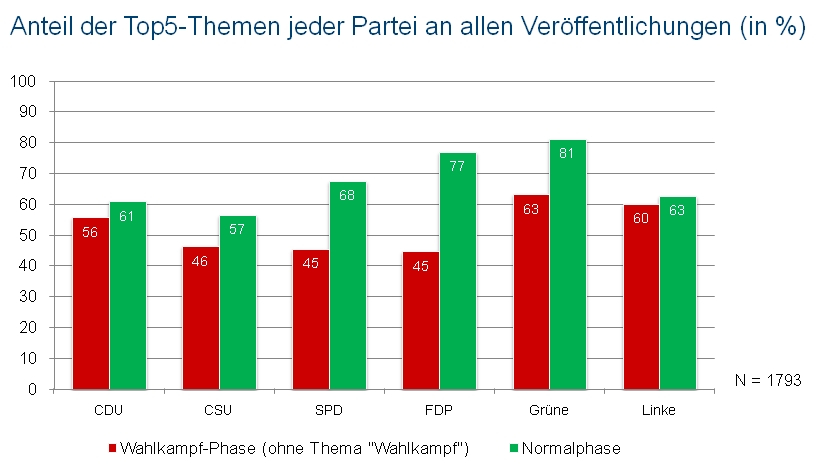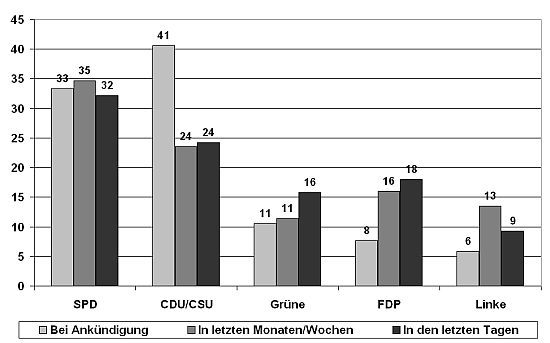Endlich Ruhe. Nach sieben Vorwahlen sowie sage und schreibe neunzehn TV-Debatten, die zeitweise nur durch unfreiwillige Komik begeistern konnten, gönnt die Republikanische Partei sich und der amerikanischen Bevölkerung einen Moment des Durchatmens. Morgen wird noch ein vorläufiges Ergebnis der Caucuses im US-Bundesstaat Maine veröffentlicht (dort erstrecken sich die Vorwahlen über mehrere Wochen, daher ist es kein Endergebnis). Danach ist zweieinhalb Wochen Pause – die längste im großen, bunten Vorwahlzirkus.
Endlich Ruhe? Mitnichten! Die Vorwahlen in den USA sind in ihrer entscheidenden Phase. Und zwar gerade, weil derzeit scheinbar nicht viel passiert. Es sind keine Delegiertenstimmen zu holen und das Medienecho ebbt ein wenig ab. Genau darin besteht aber die große Herausforderung für die Kandidaten: Sie müssen präsent bleiben, sich im Spiel halten. Denn nach der Pause folgen zwei Vorwahlen am 28.2., eine weitere am 3.3. und am 6.3. dann der „Super Tuesday“ mit Abstimmungen in elf Staaten. An diesem Tag, so schätzen viele, werden entscheidende Weichen gestellt. Schwächen kann sich hier niemand erlauben.
Die Kandidaten sprechen dieser Tage – je nach Ausgangsposition – davon, „Momentum“ generieren oder erhalten zu wollen. Das geht nur mit Werbung. Und dafür kommt es ganz entscheidend auf finanzielle Ressourcen an. Jeder Dollar, der in TV-Spots etc. investiert wird, kann sich auszahlen. In der Zeit kurz vor den ersten Vorwahlen beispielsweise haben Unterstützer von Mitt Romney dessen schärfsten Konkurrenten Newt Gingrich mittels negativer Kampagnen massiv angegriffen; der Effekt war anhand Gingrichs sinkender Umfragewerte klar erkennbar.
Diese Materialschlacht dominiert den Wahlkampf. Und wer sie gewinnt, scheint klar zu sein. Die Federal Election Commission hat unlängst offengelegt, wie viel Spendengeld die Unterstützerorganisationen der einzelnen Kandidaten im Jahr 2011 erhalten haben. Diese Zuwendungen sind im Gegensatz zu direkten Spenden an die Kandidaten nicht reguliert und so übersteigen die Ressourcen dieser formal unabhängigen Gruppierungen jene der Kandidaten bei weitem – kurz gesagt: Hier spielt die Musik.
Das Ergebnis war zu erwarten und ist deutlich. Die Gruppe um Mitt Romney hatte Ende 2011 mit Abstand am meisten Geld zur Verfügung, über 30 Millionen Dollar; Newt Gingrichs Komitee lag bei zwei Millionen (hat aber nach Ende der Berichtsperiode eine große Einzelspende erhalten), diejenigen von Rick Santorum und Ron Paul konnten jeweils rund eine Million zusammenkratzen.
Wie lässt sich solch ein Vorsprung kompensieren? Das einzige verbleibende demokratische Korrektiv im Bereich der Medien ist ausgerechnet die TV-Debatte. Hier herrscht Waffengleichheit, die Kandidaten begegnen sich auf Augenhöhe. So konnte sich beispielsweise Newt Gingrich mit überzeugenden Auftritten gegen die Attacken aus dem Romney-Lager zur Wehr setzen und prompt wieder an Zustimmung gewinnen.
Die schlechte Nachricht für Romneys finanziell minderbemittelte Herausforderer ist allerdings, dass es in der anstehenden Vorwahl-Pause bis Ende Februar nur eine Fernsehdebatte geben wird. Diese Chance müssen sie nutzen. Keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, dass die Fernsehzuschauer angesichts der mittlerweile zwanzigsten Debatte mehr und mehr ermüden. Aber es hilft nichts: Wer gewinnen möchte, muss am 22.2. live auf CNN eine flammende Rede abliefern, die rund 30 Millionen Dollar wert ist…