Eine Währung, die institutionell auf so wackligen Füßen steht wie der Euro, müsste doch eigentlich viel schwächer sein. Stattdessen befindet sich die europäische Gemeinschaftswährung seit 12 Monaten in einem ziemlich stabilen Aufwärtstrend.
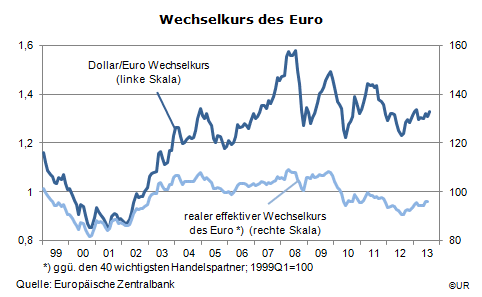
Vor allem Analysten aus dem angelsächsischen Raum sagen nach wie vor regelmäßig voraus, dass der Euro abwerten wird: Ohne eine echte Bankenunion, mit gemeinsamer Einlagensicherung und zentralen Behörden für die Bankenaufsicht sowie die Rekapitalisierung und Abwicklung von Banken, kann nach ihrer Ansicht die nächste Bankenkrise mit den Mitteln, die augenblicklich zur Verfügung stehen, nicht mehr gemeistert werden. Einige Staaten wären mit einer neuen Runde von Bankenrettungen überfordert und müssten den Euro aufgeben, weil die potenziellen Geldgeber – also Deutschland – aus politischen Gründen nicht mehr mitmachen werden. Zudem seien die finanzpolitischen und strukturellen Auflagen, die die Krisenländer schon heute erfüllen müssen, so streng und prozyklisch, dass sie deren soziales Gefüge zerstören. Auch aus diesem Grund könnte der Euro auseinanderfliegen. Es zeige sich eben immer mehr, dass er eine unvollendete Kunstwährung sei. Wegen dieses Risikos müsse er tendenziell abwerten. Daher sind die Analysten immer wieder überrascht, dass genau das Gegenteil passiert.
Die Aufwertung kann natürlich damit zu tun haben, dass die wirtschaftlichen Daten Euro-Lands insbesondere im Vergleich zu den amerikanischen ganz gut sind: In der Leistungsbilanz wird es dieses Jahr einen Überschuss von etwa drei Prozent des nominalen BIP geben, die staatlichen Budgetdefizite nähern sich aggregiert der Drei-Prozent-Marke, und die durchschnittlichen Zinsen sind höher als in den USA. So erfreulich diese Daten sind, Anleger lassen sich davon höchstens am Rande beeindrucken. Ich glaube vielmehr, die Aufwertung des Euro hat vor allem damit zu tun, dass die Marktteilnehmer dabei sind, ihr Vertrauen in den Dollar zu verlieren.
Das ist auch die Meinung von Robert Jenkins, einem früheren externen Mitglied des Interim Financial Policy Committee der Bank von England. In seinem Beitrag „Think the unthinkable on US debt“ (in: „Sovereign risk: a world without risk-free assets?„, BIS Paper Nr. 72, Juli 2013) nennt Jenkins nicht weniger als sieben Gründe, warum die Anleger das Gruseln bekommen können, wenn sie einige Dollarszenarien durchspielen, die inzwischen gar nicht mehr so unplausibel sind. Grund Nummer sieben: Es gibt den Euro – eine echte Alternative zum Dollar als internationale Anlagewährung, die spätestens, wenn sich die Bedenken über deren Zukunft einmal endgültig gelegt haben, eine Flucht aus dem Dollar wahrscheinlich werden lässt. Die relative Schwäche des Dollar und die relative Stärke des Euro reflektiert vermutlich auch diese Erwartung.
Hier in Kurzfassung die sechs anderen Gründe, weshalb es aus der Sicht von Jenkins gar nicht so gut um den Dollar steht:
- Weil die amerikanischen Staatsschulden bereits 16 Billionen Dollar erreicht haben, führt selbst ein geringer Anstieg der Renditen zu einer gewaltigen zusätzlichen Zinsbelastung im Staatshaushalt.
- Nicht weniger als 45 Prozent der gehandelten Schuldtitel des amerikanischen Staats werden von Ausländern gehalten (ganz anders als in Japan).
- Ab einem bestimmten Zinsniveau wird auch der amerikanische Schuldendienst unsustainable, kann also nicht durchgehalten werden – das dürfte ab sieben Prozent für die lange Laufzeit der Fall sein.
- Wenn US Treasuries, anders als bisher angenommen, doch keine risikolosen Papiere sind, wird es zu einer Neubewertung und zu einem massiven Ausstieg kommen.
- Professionelle Anleger, die das verstehen, werden dem Faktor „Kreditwürdigkeit“ in ihren Portefeuilles ein größeres Gewicht geben als bisher, zulasten des Faktors „Größe des Marktes“.
- Ausländische Anleger haben in den vergangenen Jahren die durchschnittliche Laufzeit (duration) ihrer Dollaranlagen verkürzt – die langen Papiere sind fast alle bei der Fed gelandet. Wenn die Ausländer also eines Tages verkaufen, dürften sich ihre Kursverluste in Grenzen halten (ein Zinsanstieg bringt am langen Ende viel größere Kursverluste mit sich als am kurzen), sie müssen also nicht aus Selbsterhaltungstrieb auf ihren Dollarpapieren sitzenbleiben, komme was da wolle.
Das folgende Schaubild zeigt, wie es um die amerikanischen Staatsschulden bestellt ist. Sie haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Das war vor allem Folge der Rettungsaktionen zugunsten der Finanzwirtschaft sowie der Rezession von 2008/2009 und des langsamen Wachstums in den Folgejahren. In Relation zum Sozialprodukt ist der amerikanische Staat inzwischen stärker verschuldet als die Regierungen der 17 Länder in der europäischen Währungsunion.
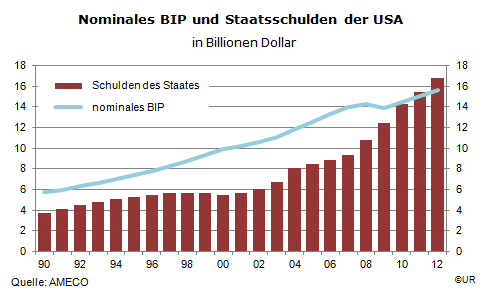
Vielleicht hat die Abwertung des Dollar auch etwas damit zu tun, dass die amerikanische Geldpolitik seit etwa einem Jahr deutlich expansiver ist als die der EZB. Das Risiko ist groß, dass die amerikanische Inflation demnächst dauerhaft rascher zunehmen wird als die europäische: Das würde die Wettbewerbssituation der US-Wirtschaft verschlechtern und damit einen schwächeren Dollar bedingen.
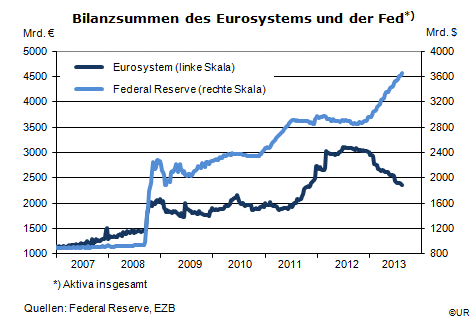
Realistischerweise lässt sich natürlich nie genau sagen, was denn einen Wechselkurs letztlich bestimmt. Die neue Euro-Stärke kommt jedenfalls etwas ungelegen, vor allem für die Länder im Euro-Raum, die ihre Auslandsschulden durch Exportoffensiven zu vermindern hoffen. Sie werden wohl kaum noch darauf setzen können, dass ihnen ein schwacher Euro dabei zur Hilfe kommt.