Für die meisten Volkswirte ist Freihandel etwas, was die Amerikaner als motherhood and apple pie bezeichnen würden – er ist einfach immer eine gute Sache und jenseits aller Kritik und Miesmacherei. Wie die Wahlen zum europäischen Parlament gezeigt haben, betrachtet aber inzwischen ein großer Teil der Menschen den scharfen Wettbewerb, mit dem Freihandel einhergeht, sehr skeptisch. Viele würden gern die Grenzen dicht machen und ausländische Produkte und Arbeiter soweit es geht draußen halten. Sie können sich nicht anpassen, verlieren ihre Jobs oder müssen mit ansehen, wie ihre Reallöhne sinken. Da ihnen die Institutionen der Europäischen Union bisher weder helfen können noch wollen, sehen sie ihr Heil in einer Renationalisierung der Wirtschaftspolitik. Wenn ich mir die Anzahl der Euro-Skeptiker im neuen Parlament und die niedrige Wahlbeteiligung ansehe, ist das europäische Friedens- und Wohlstandsprojekt nicht mehr ganz so populär wie einst. Für die Existenzabsicherung der Menschen spielt die EU kaum eine Rolle.
Die EU fördert zwar den freien Binnenmarkt für Arbeit, Kapital, Waren und Dienstleistungen, ist zuständig für die Wettbewerbspolitik und die offenen Grenzen – so wie die EZB für den frei schwankenden und angeblich tendenziell zu hohen Außenwert des Euro verantwortlich ist –, schafft damit aber auch Probleme. Deren Lösung überlässt sie den einzelnen Mitgliedsstaaten. Wir sind auf dem Weg zu einer Bankenunion, aber eine Sozialunion, mit der sich die Kollateralschäden des grenzüberschreitenden Wettbewerbs auf bestimmte Gruppen der Bevölkerung abfedern ließen, ist nicht einmal im Ansatz in Sicht. Ich halte das für einen Konstruktionsfehler.
Die große offene Volkswirtschaft Euro-Lands beteiligt sich immer intensiver an der internationalen Arbeitsteilung und kann sich nur noch schlecht gegen globale Tendenzen abschirmen. Im Jahr 1998, bevor der Euro eingeführt wurde, belief sich die Summe aus Exporten und Importen von Gütern und Dienstleistungen (extra- und intra-Euro-Raum) auf 63,2 Prozent des aggregierten nominalen Sozialprodukts der EU-17, bis zum vergangenen Jahr hatte sich diese Zahl auf 88,2 Prozent erhöht. Wir haben es hier mit so etwas wie einem ehernen ökonomischen Gesetz zu tun. So lange es nicht zu Handelsrestriktionen oder Kontrollen des Kapitalverkehrs kommt, nehmen die Ausfuhren und Einfuhren im Trend deutlich rascher zu als das BIP – für die EU-17 war ihre durchschnittliche Zuwachsrate in den letzten 15 Jahren rund 1,8 mal höher. Auch wenn ich noch länger zurückgehe, etwa bis 1960, komme ich für ein Land wie das Unsere auf eine ähnliche Relation.
Es ist offensichtlich, dass damit eine zunehmende Spezialisierung der Produktion und ein rapider Strukturwandel einhergehen. Der Außenhandel zwingt die Unternehmen, ständig neue Produkte zu entwickeln, alte zu modernisieren, Prozesse effizienter zu machen, Kosten zu senken, Produktion ins Ausland zu verlagern und neue Märkte zu erschließen. Indem dadurch die Produktivität zunimmt, nimmt auch das Produktionspotenzial zu, also der Spielraum für einen höheren Lebensstandard. Das heißt aber nicht, dass Alle davon profitieren. Es fehlt nicht an Verlierern: Die durchschnittliche Arbeitslosenquote liegt im Euro-Raum schließlich bei knapp 12 Prozent, und 15 bis 20 Millionen Menschen würden gerne arbeiten, finden aber keine Jobs.
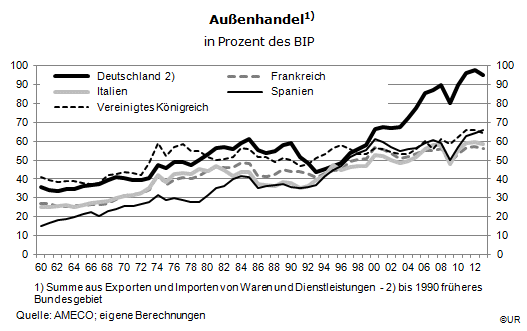
Bereits im 19. Jahrhundert, als eine (neue) Welle der Globalisierung die Weltwirtschaft von Grund auf veränderte, waren sich konservative Politiker wie Bismarck oder Robert Cecil, der dritte Marquis von Salisbury, ebenso wie auf der anderen Seite des politischen Spektrums beispielsweise Karl Marx darüber einig, dass es nicht möglich und wünschenswert sei, den Marktkräften freien Lauf zu lassen. Die ungleiche Verteilung von Einkommen und Vermögen würde über Kurz oder Lang zu Aufständen und einer Enteignung der besitzenden Klassen führen. Thomas Picketty hat in seinem Bestseller Le capital au XXIe siècle kürzlich die These aufgestellt, dass eine zunehmende Ungleichheit ein inhärentes Merkmal kapitalistischer Gesellschaften sei. Sozialpolitik dient nicht zuletzt der Systemstabilisierung.
Der Wirtschaftshistoriker Harold James von der Princeton University hatte bereits 2001 darauf hingewiesen, dass freier Wettbewerb und Sozialstaat einander bedingen. „Die (soziale) Absicherung kann sogar als Voraussetzung für den Prozess der außenwirtschaftlichen Öffnung betrachtet werden, denn ohne sie wäre es zu einer härteren und destruktiveren Reaktion gegen die neuen ökonomischen Kräfte gekommen. Der Staat, so die allgemeine Erwartung, solle insbesondere diejenigen schützen, deren Existenz durch ausländische Produkte bedroht wurde.“ (zitiert nach der deutschsprachigen Ausgabe seines Buches The End of Globalization, S. 38). Der Anteil der Sozialausgaben am deutschen Staatshaushalt hatte 1912, kurz vor dem 1. Weltkrieg, fünf Prozent erreicht. Nach dem Krieg war er rasant weiter gestiegen, auf 34,2 Prozent im Jahr 1928, und dann noch einmal sehr kräftig nach dem 2. Weltkrieg. In anderen Industrieländern war es ähnlich.
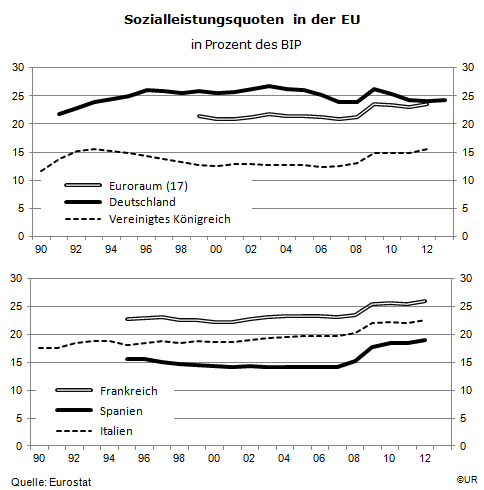
Im Jahr 2013 machten die deutschen Sozialleistungen 54,3 Prozent der gesamtstaatlichen Ausgaben aus, oder 24,3 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts. Diese Anteile schwanken in Reaktion auf den Verlauf der Konjunktur, vor allem den der Arbeitslosigkeit. Aber der Trend weist nach oben. Dabei ist die deutsche Arbeitsmarktpolitik ja vergleichsweise erfolgreich.
Der große Abstand zu den Sozialquoten in den ärmeren Ländern der EU macht es attraktiv, nach Deutschland auszuwandern. Das wiederum erzeugt hierzulande Ressentiments. Anders als in Frankreich und Großbritannien halten sie sich allerdings bislang im Rahmen. Da die Beschäftigung zügig steigt und auch durch die tiefe Rezession von 2008 / 2009 kaum beeinträchtigt wurde, gilt Globalisierung nach wie vor als etwas Positives. Auch die Zuwanderung von netto 437.000 im Jahr 2013, die zweithöchste der Welt, hat keine Debatten darüber ausgelöst, ob es nicht an der Zeit sei, hier mal einen Riegel vorzuschieben. Die Debatte über die demografische Zukunft, vor allem also über die Sicherheit der Renten, hat den Leuten klar gemacht, dass Einwanderer gebraucht werden. Lasst doch die Jungen kommen. Die Alten wandern derweil nach Spanien, Florida und Thailand aus. Insgesamt kommt Deutschland außer im östlichen Teil gut mit dem Strukturwandel durch die internationale Arbeitsteilung zurecht. Die Sozialsysteme sind im großen Ganzen belastbar.
Warum das in Frankreich und Großbritannien, aber auch in Italien und Spanien, den anderen Schwergewichten in der EU, nicht so gelingt, ist nicht unmittelbar einsichtig. Vielleicht wurde die Deindustrialisierung zu rasch vorangetrieben (wie in Großbritannien), vielleicht hat der Staat zu sehr auf nationale Champions statt auf den Mittelstand gesetzt (wie in Frankreich), vielleicht wurde zu lange ein Bauboom zugelassen, der zu einem mittelfristig ineffizienten Einsatz der Ressourcen geführt hat (wie in Spanien). Jedenfalls sollte den europäischen Politikern bewusst sein, dass die Vorteile der Globalisierung so groß sind, dass die Verlierer vom Staat, also der Solidargemeinschaft, problemlos finanziell abgesichert werden können. Wichtig ist darüber hinaus, dass die Anreize für Umschulungen und Mobilität verstärkt werden. In gewisser Weise verfügt Deutschland in dieser Hinsicht über ein Exportmodell.