In Deutschland, Europa und in der Welt insgesamt könnte es wirtschaftlich kaum besser laufen, wenn man mal von der immer ungleicheren Verteilung von Einkommen und Vermögen absieht. Das Wachstum ist robust, die Arbeitslosigkeit sinkt stetig und ist in Ländern wie den USA oder Deutschland auf Vollbeschäftigungsniveau gesunken, die Inflation ist eher zu niedrig als zu hoch, und die Geldpolitik ist entweder extrem expansiv, wie im Euroland oder Japan, oder vorsichtig restriktiv, wie in den USA. Von daher überrascht es nicht, dass sowohl die Aktienmärkte als auch die Bondmärkte haussieren. Aber die Kurse haben fast überall astronomische Werte erreicht, die sich längst nicht mehr durch die gesunde Wirtschaft und die expansive Geldpolitik rechtfertigen lassen.
Warum platzen die Blasen nicht?
Geht es nach dem konjunkturell bereinigten Kurs-Gewinn-Verhältnis der US-Aktien, wie es Robert Shiller für die Zeit ab 1880 berechnet hat (cyclically adjusted price to earnings ratio „CAPE“), ist ein größerer Rückschlag seit Februar 2013 überfällig. In dem Monat hatte die Kennziffer zuletzt wieder den kritischen Wert von 22 überstiegen. Nach Shiller war es in der Vergangenheit in den drei Jahren nach dem Passieren dieser Marke zu einem durchschnittlichen Kursrückgang von 21 Prozent gekommen. Seit Anfang 2013 ist der S&P 500 – der Leitindex der USA und damit der Welt – um weitere 69 Prozent gestiegen und hat jetzt ein CAPE von 31,2 erreicht. Eine solch hohe Bewertung hatte es zuvor nur 1929 und gegen Ende der neunziger Jahre, auf dem Höhepunkt der Tech-Blase, gegeben. Wir haben es also mit einer gefährlichen Überbewertung zu tun.
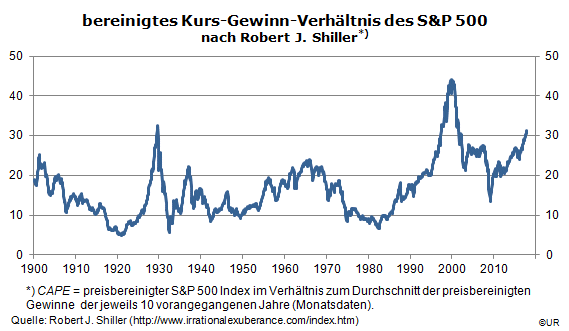
In Deutschland ist es nicht ganz so krass: das CAPE des DAX liegt zurzeit bei 25,4.
Ein Grund für die Euphorie an den Aktienmärkten sind die niedrigen Renditen an den Bondmärkten, die Zweierlei reflektieren: die unerklärlich niedrigen Zuwachsraten der Löhne und Verbraucherpreise sowie die Politik des quantitative easing der Zentralbanken, zuletzt vor allem der EZB. Die „reale“ Risikoprämie, die in den Aktienkursen enthalten ist, ist vor allem in Amerika sehr niedrig. Auf CAPE-Basis gerechnet beträgt die des S&P 500 rund 2,8 Prozentpunkte [= Gewinnrendite von 1/31,2 mal 100 minus der Rendite auf 10j. Treasuries von 2,44 Prozent abzgl. der Inflationserwartung von zwei Prozent]. Beim DAX komme ich nach dieser Rechnung auf 5,3 [=100/25,4 – (0,48 – 1,8)], was nach aller Erfahrung ein dickes Risikopolster ist und den Markt gut abschirmt gegen das Risiko eines größeren Rückschlags, insbesondere einen starken Anstieg der Inflationsraten und Bondrenditen. Hinzu kommt, dass die EZB bisher darauf besteht, dass die Zinsen auf absehbare Zeit nicht erhöht werden, mindestens jedoch bis zum Ende des Bond-Ankaufsprogramms, also voraussichtlich erst in der zweiten Jahreshälfte 2018.
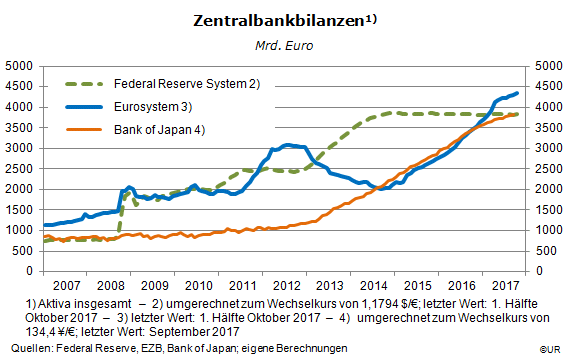
Anleger sind daher gut beraten, ihr US-Risiko zu verringern und in deutsche und andere europäische Aktien umzuschichten. Nach den guten Konjunkturdaten der vergangenen Monate sollten sie allerdings einen großen Bogen um die Bondmärkte schlagen. Die Zahlen, die das ifo-Institut am Mittwoch veröffentlicht hat, sind ein weiterer Beleg dafür, dass in Deutschland so etwas wie Hochkonjunktur herrscht. Auch in den übrigen Ländern der Währungsunion brummt die Wirtschaft. Die Zinswende rückt daher näher, auch wenn es bei den aktuellen Löhnen und damit bei den Verbraucherpreisen noch nicht danach aussieht und die EZB versucht, jede Spekulation darüber zu unterbinden.
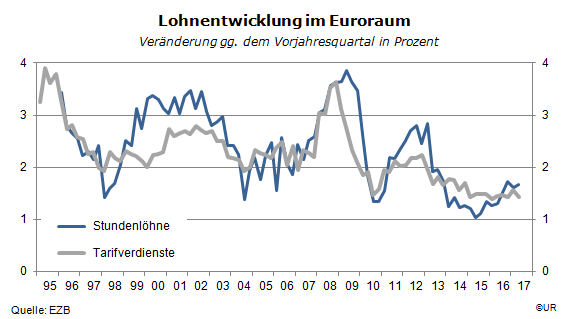
Sobald sich am Markt die Einsicht durchsetzt, dass sich negative beziehungsweise Nullzinsen aus konjunkturellen Gründen nicht halten lassen, kann es sehr schnell gehen. Schließlich muss die EZB ja auch für den Fall vorsorgen, dass es eines Tages wieder zu einer Rezession kommt und mit Zinssenkungen gegengehalten werden muss. Vom jetzigen Zinsniveau aus geht das schlecht. Unter den Annahmen, dass das Produktivitätswachstum mittelfristig allen Spekulationen über eine „säkulare Stagnation“ zum Trotz nach wie vor bei rund ein Prozent liegt und die EZB ihr Inflationsziel von knapp unter zwei Prozent erreichen wird, müssten die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen von jetzt 0,5 auf ein „Normalniveau“ von drei Prozent steigen, unter Berücksichtigung einer Risikoprämie von vielleicht 0,5 Prozentpunkten für die lange Laufzeit eher sogar auf 3,5 Prozent. Ein solcher Anstieg bedeutet einen Kursverlust von fast 30 Prozent.
Anleger können sich nur davor schützen, indem sie ihre Bondbestände vermindern oder die Restlaufzeiten deutlich vermindern. Eine solche Strategie bedeutet allerdings, dass sie das herbeiführen, wovor sie sich fürchten. Für den Gesamtbestand an Bonds, die auf Euro lauten, funktioniert das im Übrigen nicht – für den Rentenmarkt als Ganzes gibt es keinen Schutz vor Kursverlusten. In den USA ist die Kurskorrektur bei den Festverzinslichen schon deutlich weiter fortgeschritten als im Euroraum, so dass sich eine vorsichtige Umschichtung in Dollarpapiere anbietet, wenn das Volumen des Rentenportefeuilles annähernd konstant gehalten werden soll.
Aus heutiger Sicht dürfte ein Kurswechsel der EZB der entscheidende „hausgemachte“ Auslöser für einen Kurseinbruch am Aktienmarkt sein. Je länger der Zeitpunkt hinausgeschoben wird, desto weiter werden sich die Aktienkurse von vertretbaren Bewertungen entfernen und desto schmerzhafter wird der unvermeidliche Rückschlag sein.
In der öffentlichen Diskussion wird im Allgemeinen unterschätzt, was für ein Segen der schwache Euro bisher für die Konjunktur war. Die Schwäche reflektiert nicht nur die im Vergleich zu den USA lockere Geldpolitik der vergangenen Jahre, sondern auch die immer wieder neu belebten Zweifel an den mittelfristigen Überlebenschancen des Euro. Ich vermute, dass diese Zweifel nach den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich und dem erkennbaren Willen der Regierungen, die europäischen Institutionen wetterfester zu machen, weiter abnehmen werden. Die spanische Krise hat sich bezeichnenderweise so gut wie gar nicht auf die Märkte ausgewirkt – der Zinsspread zwischen spanischen und deutschen Staatsanleihen ist heute etwa so groß wie zu Beginn des Jahres, als das katalanische Unabhängigkeitsstreben noch kein Thema war (circa 110 Basispunkte bei den Zehnjährigen).
Das bedeutet aber auch, dass ein wichtiger Grund für die Euroschwäche allmählich entfällt. Da die Leistungsbilanz des Euroraums einen gewaltigen Überschuss aufweist – voraussichtlich 350 Mrd. Euro in diesem Jahr – und die aggregierten staatlichen Haushalte nur ein Defizit von 1,2 Prozent des BIP erreichen dürften, könnten die Fundamentalfaktoren, die den Wechselkurs bestimmen, im internationalen Vergleich gesünder nicht sein. Irgendwann wird dann im nächsten Jahr zudem die Wahrscheinlichkeit einer Trendwende in der Geldpolitik, also steigender Zinsen, deutlich zunehmen. Wir müssen uns daher auf einen festen Euro einstellen. Noch dürfte der Euro handelsgewogen um mindestens 10 Prozent unterbewertet sein, so dass die negativen Effekte einer Aufwertung auf die Konjunktur bis auf weiteres nicht allzu sehr ins Gewicht fallen dürften. Aber erinnern wir uns: Der Euro hatte in der Vergangenheit schon einmal an der Marke von 1,60 Dollar gekratzt. Wenig spricht dagegen, dass es in den kommenden Jahren wieder in diese Richtung gehen wird.
Auch das wäre im Übrigen ein plausibler Auslöser für eine größere Korrektur der europäischen Aktienmärkte. Ich vermute allerdings, dass es nicht so lange dauern wird. Vorher werden die extrem teuren amerikanischen Aktien korrigieren und den Rest der Welt, auch Europa, mit hinunterziehen. Eine neue globale Rezession wäre dann ziemlich wahrscheinlich. Ich frage mich, wie die EZB dann reagieren will. Spielraum hat sie bisher noch nicht – was nichts Anderes heißt, dass es dann zu einer Renaissance der Finanzpolitik kommen wird.
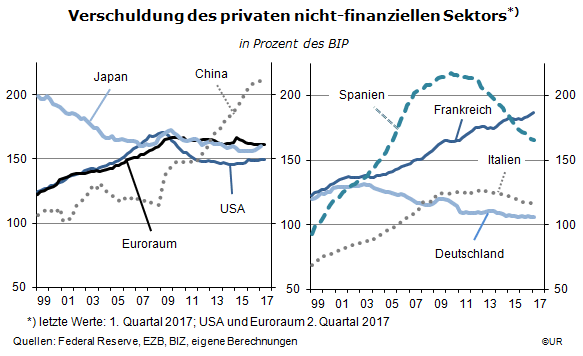
Wie die obige Grafik zeigt, sollte darüber hinaus nicht vergessen werden, dass die Verschuldung der privaten nicht-finanziellen Sektoren in den meisten großen Industrieländern, aber auch in China, in Relation zum Sozialprodukt weiterhin sehr hoch ist. In China und in Frankreich nimmt sie nach wie vor rapide zu. Zwar sind die Schulden der Einen das Vermögen der Anderen und insofern volkswirtschaftlich sinnvoll, aber je höher der Schuldenstand im Vergleich zum Einkommen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Überschuldung kommt, dass also der Schuldendienst die Erträge aus den schuldenfinanzierten Immobilien, Aktien, Bonds und Rohstoffen übersteigt und eine Kette von Insolvenzen auslöst. Der nächste Einbruch der Vermögenspreise, die nächste Finanzkrise und möglicherweise die nächste globale Rezession könnten die Folge sein.