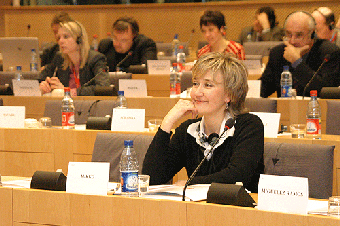Ein Jahr als Korrespondent in Brüssel. Eine Bilanz
Auf einem sektschwangeren Atem reitet mir ein abfälliges Lachen entgegen. „Ha! So wenige?“ Die deutsche Diplomatin hält die Zahl, die ich ihr, nach einem zu kurzen Moment des Zögerns, doch verraten habe, für einigermaßen armselig. Nur knapp dreißig Visitenkarten eingesackt in der ersten Woche als Korrespondent in Brüssel? Am Rand ihres hochstieligen Glases zeichnet sich der Lippenstiftabdruck eines milden Lächelns ab.
Ein Jahr später weiß ich dreierlei. Erstens, auf die Anzahl kommt’s nicht an. Zweitens, dass der zwanghafte Austausch von Kärtchen auf Brüsseler Abendempfängen bisweilen der Geisteshaltung beim Ausfüllen eines Lottoscheins ähnelt: Wer weiß, vielleicht bringt es ja doch was, wenn schon nicht beruflich, dann womöglich privat. Aber drittens ist mir auch klar geworden, dass wenn einmal das große Los auf Europa fällt, Brüssel der Ort ist, der sich wie kein anderer als Kollektiv darauf stürzt, ein Ereignis zu kanalisieren, analysieren und parieren. Als Netzwerk dürfte sich die Stadt zu einem der dichtesten der Welt gemausert haben. Brüssel ist Google in der Echt-Welt. Man findet alles und jeden. Aber auch vieles, was man nie gesucht hat.

Meiden Sie zuviel Champagner, er ruiniert Ihre Magenschleimhaut
Während der ersten Wochen fühlt sich das Arbeiten in der „EU-Hauptstadt“ (ein etwas bemühtes Reiseführersynonym) so psychedelisch an, als säße man inmitten eines beständig implodierenden Sternenhaufens. Brüssel stürzt sich auf den Neuankömmling wie ein Heuschreckenschwarm auf ein unberührtes Weizenfeld; sanfte Korruption und plötzliche Duz-Attacken eingeschlossen. Das EU-Viertel vermittelt seinen Bewohnern das wärmende Gefühl, sie seien unter sich, unbeobachtet von der wahren Welt sozusagen.
Rund um den Place Schuman mit seinen klobigen Bürogebäuden und ausgedehnten Fressmeilen herrscht die Betriebsamkeit eines Großflughafens und die Mentalität eines Dorfes. „Neenee! Lassen Sie mal. Sie wurden gelobbyt!“, flötet der Gesprächspartner am Ende eines hervorragenden, nicht ganz günstigen Mittagsessens, und zückt die eigene Geldbörse. Aufgeschlossen und gelöst wie nie begegnet einem hier auch der BND-Mann, den man noch aus anderen Zeiten kennt. Und da ist die Kommissionsbeamtin, die mit ernster Miene über die viele Arbeit klagt, aber noch viel schamloser über all den Champagner, der ihr, „echt jetzt!“, die Magenschleimhaut ruiniert habe.
Pling!, jubelt der Computer, als der Korrespondent wieder ins Büro zurückkehrt. E-Mail vom Deutschen Tierschutzbund. Freude darüber, dass die EU ein Handelsverbot für Hunde- und Katzenfelle beschlossen hat. Pling! Die Sozialisten im Europaparlament planen eine Pressekonferenz über die Mehrwertsteuerstreichung für Kondome. Pling! Die bayerische Landesvertretung lädt zur „Wurstverkostung“.
Ring! Das Telefon klingt. Der Herr am anderen Ende macht sich nicht die Mühe, sich vorzustellen. Er sagt nur auf Englisch: „Guten Tag. Wir hätten gerne ihre Adresse für unsere Datenbank.“ Ich sage „eher nein“, aber noch während ich den Hörer auflege, beschleicht mich das Gefühl, gerade ein wichtiges Brüsseler Grundgesetz verletzt zu haben. Werde ich nun die alles entscheidende E-Mail nicht bekommen? Die, über die morgen die ganze Stadt spricht? Ja, schlimmer: Bin ich jetzt ein Anti-Europäer?
Kurze Zeit später treffe ich glücklicher Weise einen alten Studienfreund, den es mittlerweile ebenfalls „in die EU“ verschlagen hat. Oh ja, sagt er, er kenne diese Angst. Dann fragt er, ob ich mich an die Star Trek-Filme mit den Maschinenmenschen erinnere, diese „Borg“. Ich nicke. Sie werden assimiliert!, tönte deren blecherner Kampfruf. Der Freund lächelt und nickt. Und hat Recht. Widerstand gegen die Rundum-Verdrahtung, merke ich bald, ist ohnehin zwecklos.
Wer länger in Brüssel lebt, hat keine Wahl. Eine Hälfte seines Gehirns gehört schnell der EU. Es vergehen keine drei Monate, und man ertappt sich dabei, dass man beim Feierabendbier mit einer jungen Dame zwei Stunden lang heißblütig über den Lissabon-Vertrag debattiert hat. Sowas gilt hier nicht als Fauxpas. Es ist total en vogue. Als nächstes beginnt man, unmerklich französische Floskeln in seinen Wortschatz einzuflechten und wildfremde Menschen mit zwei Küsschen auf die Wange zu begrüßen.
Vermutlich ist es auch kein gutes Zeichen, dass ich schon überlegt habe, meinen Kühlschrank zu verkaufen. Aber Brüssel nährt seine zugereisten Töchter und Söhne einfach zu gut.
„Frieden!“, ruft Ministerpräsident Kurt Beck ins Mikrofon. Er ist zu Besuch in die rheinland-pfälzische Landesvertretung gekommen und muss europäisch klingen. „Wohlstand!“ Das Publikum beginnt zu rumoren. „Grenzenlosigkeit!“ „Wir!“ „Alle!“ „Menschen!“ Die Menschen verteilen sich. „Nachbarn!“ Aus, vorbei. Wenn Politiker bei Ansprachen die Karlspreis-Vokabeln auspacken, wendet sich das Publikum freundlich ab; es weiß, jetzt dauert es nicht mehr lange, bis das Buffet eröffnet wird. Die Beschwörung der EU als Kriegsverhinderungsbündnis taugt noch als Brüsseler Tischgebet. Keiner glaubt mehr recht daran, aber etwas Besseres, nach vorn Weisende, will auch niemandem einfallen. Bis es soweit ist, tröstet man sich mit Rindercarpaccio und Lachshäppchen. Brüssel mag ein Wartesaal der Geschichte sein – aber einer mit exzellentem Catering.

Ich war noch nie im Atomium. Und auch noch nie beim Manneken Pis
Eines Tages fällt mir auf, dass ich noch nie draußen beim Atomium war, einem, so sagt man, beliebtem Ausflugsziel vieler Belgier. Ich war auch noch nie beim Manneken Pis und auch noch nie im Comic-Museum. Offen gesagt hat das damit zu tun, dass ich ungern daran erinnert werde in einer Stadt zu leben, die einen erheblichen Teil ihrer internationalen Bekanntheit auf ein urinierendes Kleinkind und auf die Abenteuer von Tim und Struppi stützt. Dann jedoch erzählt mir eine deutsche Bekannte, irgendwelche Belgier hätten dem Manneken Pis kürzlich ein schwarzes Lacklederkostüm übergezogen. Wir finden das putzig. Und beschließen, sie einmal zu suchen, diese Belgier. Ein Freund meiner Bekannten, sagt, er kenne in der Nähe der Oper ein Lokal, wo man welche finde. Belgier.
Am nächsten Samstag sitzen wir an einem rauen Holztisch in der wunderschönen mittelalterlichen Innenstadt, nippen am Starkbier und blicken neugierig in den Thekenraum. Es dauert nicht lang, und unsere Bekannte wird zum Tanzen aufgefordert – von einem italienischen Journalisten. Der Freund und ich unterhalten uns den Rest des Abends über die bildungspolitischen Auswirkungen des Lissabon-Vertrages. – Sollte mich irgendwann mal jemand fragen, ob ich einmal in Belgien gelebt habe, werde ich antworten Nein. Ich habe an den Mauern einer Institution campiert.
Brüssel, seien wir ehrlich, ist ein gutes Beispiel dafür, dass eine Parallelgesellschaft wunderbar funktionieren kann, wenn Einwanderer und Ureinwohner aus demselben Kulturkreis kommen und schon zwei Weltkriege gegeneinander ausgefochten haben.
Wahrscheinlich hat auch Angela Merkel auch noch nie einen Belgier zu Gesicht gekriegt und empfindet das nicht als störend. Wenn die Staatschefs oder ihre Minister in Brüssel zusammenkommen, dann tagen sie im hermetischen Ratsgebäude „Justus Lipsius“. Der Granit-Kubus besitzt die Anziehungskraft eines Grabsteins, und seine Innenarchitektur changiert je nach Stockwerk zwischen der Spröde einer Kleinstadteisdiele und der Hermetik von Gefängnisfluren. Nach jeder Ratspräsidentschaft hinterlässt das entsprechende Land ein Andenken im Interieur; Stühle, Sessel, Lampen, Beistelltischchen. Das Ergebnis ist ein verwirrendes Sammelsurium edler, hochwertiger Kleinteiligkeit.
Zum Glück gibt es sie, die Politiker, die mit den Füßen scharren, die jetzt, endlich einmal, mehr mit diesem Brüssel anstellen wollen als eine Bauchnabelschau nach der anderen zu veranstalten. Lissabon, eine laue Nacht am Meer. Angela Merkel stellt sich den Journalisten, eine blaue Sternenwand und einen historischen EU-Gipfel hinter sich. Eigentlich möchte sie jetzt gar keine Fragen mehr zum neuen Reformvertrag, ehemals EU-Verfassung, beantworten. Nein, vielleicht, lässt die Kanzlerin durchblicken, könnte sich diese Union der 27 stattdessen endlich einmal darüber unterhalten, was sie eigentlich in der Welt erreichen wolle. Darüber zum Beispiel, „welche Interessen Europa in Bezug auf die Globalisierung hat“. Schweigen im Presserund. Dann eine kritische Frage zum Flugverhalten der EU-Politiker. Welch ein immenser CO2-Ausstoß! Sei das denn vorbildlich?
Womöglich, denkt der Neuling, hätte die Kanzlerin doch gerne andere Themen vertieft. Warum, zum Beispiel, sich Brüssel immer noch wie die Heimstatt einer gewaltigen NGO anfühlt. Warum die Gipfel seiner 27 Regierungschefs oft wie die Treffen einer Selbstfindungsgruppe wirken. Warum dieser unglaublich durchorganisierte Club unglaubliche 40 Milliarden Euro pro Jahr für seine Milchkühe, Olivenbäume und Schafherden ausgibt, während China in Universitäten und Containerhäfen investiert.
Ja weil, Herrgott, die EU eben ihre Fehler hat, wie alle komplexe Gebilde, sagen erfahrenere Beobachter. „Wissen Sie“, weiht mich ein deutscher Kollege ein, „ich bin jetzt seit elf Jahren hier. Und ich bin immer noch“ – er zögert – „überzeugter Europäer.“ Würde ein Berliner Korrespondent, fragte ich mich, allerdings auch sagen, er sei überzeugter Bundesrepublikaner? Brüssel entfaltet schon eine Sogwirkung eigener Art auf den Berichterstatter, vergleichbar vielleicht mit dem Lullen eines Folksingers. Hey, Mann, wir bauen hier an Größerem! Willst du da ein kleinlicher Kritiker sein? Auf diesen Geist verlassen sich oft auch Politiker. Er habe in Brüssel immer gewusst, sagt Cem Özdemir vor großem Publikum (sämtliche deutschen politischen Stiftungen laden einmal im Jahr zu einem gemeinsamen Empfang an, dann drängeln sich 2000 Gäste vor Grillzelten), dass die Journalisten in Brüssel „unsere Verbündeten“ seien, anders als in Berlin. Dafür bekam er sogar noch Beifall von den versammelten Stiftungsmitarbeitern.
Es gibt Politiker, die diesem politischen Stockholm-Syndrom erliegen, sobald sie auch nur wenige Minuten von Brüsseler Publikum umzingelt sind. Markus Söder von der CSU, zum Beispiel. Er ist zur Wurstverkostung in die Bayern-Vertretung gekommen. Ein kühles Glas Bier in der Hand, sagt er mit tiefer Stimme in eine Runde von Journalisten: „Brüssel ist eine der Hauptstädte der Welt. Neben Washington, Peking und London ist Brüssel eine der Hauptstädte der Welt.“
Ich schreibe das sehr sorgfältig mit und denke, Brüssel ist wirklich spannend und lehrreich. Aber wenn ich das irgendwann glaube, dann ist es Zeit zurückzukehren, in die Welthauptstadt Hamburg.