Es könnte sein, dass wir, ohne es zu merken, auf einem Pulverfass tanzen. Die Musi spielt, wir sind optimistisch und guter Dinge, und es gibt kaum einen Grund, sich Sorgen zu machen.
Der Weltwirtschaft geht es besser als je zuvor. Gemessen am realen BIP wächst sie nunmehr schon im sechsten Jahr mit fast 5 Prozent. Die Inflationsrate der Verbraucherpreise wird sich weltweit bei 3 1/2 Prozent einpendeln, das kommt unserem Verständnis von Preisstabilität sehr nahe. Dass alles hervorragend läuft, finden auch die Anleger, die die Volatilität der Vermögenspreise und die Risikoprämien auf historische Tiefstände getrieben haben. Die Gewinne der Unternehmen entwickeln sich prächtig und die Beschäftigung nimmt weltweit mit Raten von rund 2 Prozent pro Jahr zu. Es ist alles zu schön, um wahr zu sein. Ist es zu schön?
Noch nie hat es an den Märkten so viele Ungleichgewichte, so viele Bubbles oder Blasen gegeben wie heute. Das sind aus ökonomischer Sicht Verzerrungen von Marktpreisen, die eines Tages mit großer Wahrscheinlichkeit korrigiert werden, und zwar dann, wenn sich herausstellt, dass die künftigen Erträge nicht im Einklang mit den Ertragserwartungen stehen, die bisher in die Kurse eingegangen sind. Jede einzelne Blase ist beherrschbar, aber da es so viele sind, könnte es vielleicht doch systemische Risiken geben, also Risiken, die die Weltwirtschaft insgesamt in die Knie zwingen können.
Abgesehen von Wertpapiermaklern, für die die Kurse fast immer niedrig, und daher günstig für einen Einstieg sind, machen sich immer mehr Institutionen und ernsthafte Volkswirte Gedanken über die Stabilität der Finanzmärkte. Da Crashs meist erhebliche Rückwirkungen auf die reale Seite der Wirtschaft, auf das Wachstum und den Arbeitsmarkt, haben, handelt es sich um mehr als nur um akademische Gedankenspiele.
Die Literatur zum Thema ist fast schon unüberschaubar. Ich empfehle allen, die sich näher damit beschäftigen wollen, einmal auf die Home Pages der Bank for International Settlements, der EZB, der Bank of England und vor allem des IMF zu gehen und sich deren Stabilitätsberichte anzusehen. Von der Bundesbank erschien im letzten November ein 135-seitiger „Finanzstabilitätsbericht“, und im jüngsten Wirtschaftsdienst des ZBW, der Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften, gibt es von Andreas Hoffmann und Gunther Schnabl einen lesenswerten Beitrag mit dem Titel „Geldpolitik, vagabundierende Liquidität und platzende Blasen in neuen und aufstrebenden Märkten“.
Wenn eine Blase platzt, zeigt sich stets, dass der realisierbare Wert der Aktiva viel niedriger ist als bislang gedacht. Vor allem wenn im Spätstadium der Kursbewegung mit viel Fremdkapital, sogenannten Hebeln, gearbeitet wurde – was wiederum für Blasen typisch ist -, kann es geschehen, dass die Verbindlichkeiten den Marktwert des Vermögens überschreiten. Die Nettovermögensposition für die Schuldner (die Spekulanten) wird dann plötzlich negativ. Sie sind überschuldet und müssen im ungünstigen Fall in Konkurs gehen, im günstigen Fall werden sie versuchen, ihre Bilanzen dadurch zu reparieren, dass sie auf die Kostenbremse treten, weniger investieren oder, soweit es sich um Haushalte handelt, mehr zu sparen, also weniger zu konsumieren. Auf alle Fälle kommt es unter dem Strich zu einem mehr oder weniger deutlichen und mehr oder weniger lang anhaltenden Rückgang der Wachstumsraten des BIP.
Insgesamt sind die Effekte deflationärer Natur. Wie das Beispiel der verlorenen Dekade in Japan zeigt, kann das soweit gehen, dass selbst nominale Zinsen von null Prozent oder gewaltige staatliche Haushaltsdefizite jahrelang nicht anschlagen – niemand braucht Geld, wenn es vor allem darum geht, Schulden abzubauen. In einer richtigen post-Blasen-Situation haben wir es mit einem Potenzverlust der Wirtschaftspolitik zu tun.
Um das zu relativieren: Nicht alle Blasen platzen mit einem großen Knall, manchmal entweicht das Gas auch nur mit leisem Zischen. Im Fall der spanischen und amerikanischen Immobilienkrisen beschränken sich die negativen Effekte, bislang zumindest, nur auf relativ kleine Teile der Volkswirtschaft und scheinen von daher beherrschbar zu sein.
Als Mutter aller Bubbles gilt das amerikanische Leistungsbilanzdefizit. Es beträgt rund 6,5 Prozent des nominalen Inlandsprodukts. In der Vergangenheit hat schon ein deutlich kleineres Defizit am Ende zu einer gewaltigen Abwertung des Dollars geführt. Diesmal ist sein Wechselkurs erstaunlich stabil, weil Anleger in der ganzen Welt bisher mehr als bereit sind, US-Akitiva zu erwerben, also das Defizit zu finanzieren. Hinzu kommt wohl auch, dass die Erträge aus den amerikanischen Auslandsanlagen viel höher sind als die Zahlungen an die ausländischen Gläubiger und Besitzer von US-Aktiva, so dass an den Devisenmärkten das Netto-Angebot an Dollar nicht so groß ist, wie man vermuten könnte. Der Grund hierfür ist offenbar, dass das amerikanische Auslandsvermögen vorwiegend aus Direktinvestitionen und Aktien besteht, deren Erträge vermutlich um etwa vier Prozentpunkte über den Kosten der höheren Verbindlichkeiten liegen; die zu einem nicht geringen Anteil aus festverzinslichen Wertpapieren bestehen.
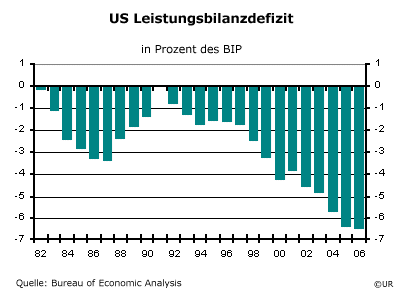
Dennoch ist die Lage sehr instabil. Amerika muss ständig attraktive Erträge auf seine Verbindlichkeiten bieten, oder jedenfalls die Aussicht darauf lebendig halten, damit die ausländischen Gläubiger bei der Stange bleiben. Wenn diese allmählich nicht mehr wissen, was sie mit all den Dollars anfangen sollen, wie die chinesischen oder russischen Notenbanken, oder wenn, wie jetzt, die Unternehmensgewinne kaum noch steigen, nimmt das Risiko einer weiteren größeren Korrektur des Dollarkurses zu. Es könnte zum Dollarcrash kommen, was für die Exportwirtschaft in weiten Teilen der Welt beträchtliche Probleme mit sich bringen würde.
Die Kehrseite der amerikanischen Leistungsbilanzdefizite ist die Liquiditätsschwemme in den Ländern, die den Wechselkurs des Dollars entweder stabil halten oder nur kontrolliert abwerten lassen wollen. Ihre Währungsbehörden kaufen in großem Stil Dollars und emittieren im Gegenzug ihre eigene Währung. Seit einigen Jahren nimmt die sogenannte Geldbasis der Welt mit Raten von 15 Prozent und mehr zu, vor allem weil die Währungsreserven um ein Vielfaches rascher expandieren als das nominale Sozialprodukt, dessen Zuwachsrate eher bei 7 oder 8 Prozent liegt. In Russland übertrifft die Geldmenge M2 ihren Vorjahresstand um 53 Prozent, in China um 17,1 Prozent.
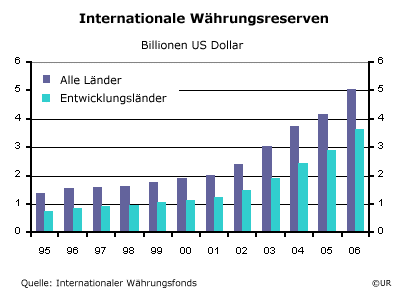
In beiden Ländern sind daher die Immobilienpreise explodiert. Ob es sich um Blasen handelt, ist nicht ausgemacht, weil der Nachholbedarf nach den vielen Jahrzehnten, in denen es nur um die Verwaltung des Mangels ging, gewaltig ist, und die hohen Inflationsraten in diesem Bereich jetzt das Angebot stimulieren, wie es in einem marktwirtschaftlichen System ja auch zu erwarten ist. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass die Leute auch deswegen immer mehr Immobilien erwerben, weil sie darauf spekulieren, dass sowohl die eigenen Einkommen als auch die Preise auf Jahre hinaus mit den zweistelligen Raten der jüngeren Vergangenheit zunehmen werden. Das könnte sich als Fehlspekulation erweisen.
In China kommt hinzu, dass die Aktienmärkte seit Jahren boomen und die Bewertungen inzwischen jede Bodenhaftung verloren haben. Neue Emissionen sind manchmal um das Hundertfache und mehr überzeichnet. Alle Taxifahrer und Hausfrauen scheinen in der Hoffnung auf das schnelle Geld mit von der Partie zu sein – was in der Regel Alarmstufe 1 bedeutet. Auch hört man, dass immer mehr Ersparnisse in Aktien gesteckt werden, und häufig sogar mehr als nur das. Sollte es in China demnächst zum großen Knall kommen, so wie einst in Japan, bräche sofort die Nachfrage nach Öl, Gas und anderen Rohstoffen ein, wodurch wiederum, zumindest in der ersten Runde, Länder wie Russland, Kanada, Südafrika und die diversen OPEC-Länder betroffen wären. Deren Traum vom ewig steigenden Wohlstand, den ihnen die Terms of Trade bisher beschert haben, wäre dann ausgeträumt. Nicht nur das, auch die deutschen oder japanischen Exporteure, die so stark vom Boom der Schwellenländer profitiert haben, hätten auf einmal mit Absatzproblemen zu kämpfen, was natürlich negative Rückwirkungen auf Wachstum und Beschäftigung hätte.
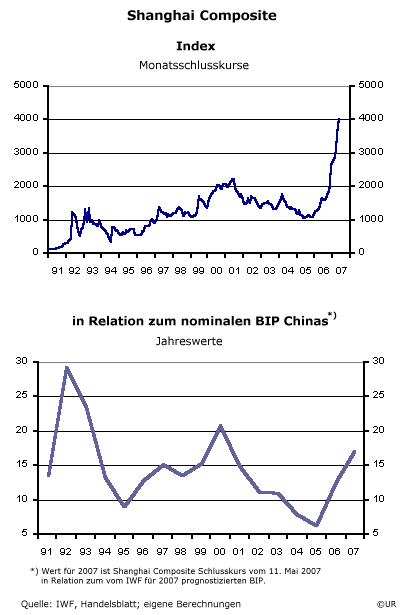
Blasen entstehen immer dann, wenn es keinen Grund für die Befürchtung gibt, dass die Notenbanken und die Finanzpolitik die Zügel fühlbar anziehen könnten. Das ist seit einiger Zeit im Weltmaßstab der Fall. Das Wirtschaftswachstum ist zwar sehr hoch, die Inflation ist aber moderat. Die Liquidität geht in die Assets, nicht in die Verbraucherpreise.
Vor allem am Arbeitsmarkt scheint es noch Reserven zu geben, so dass die Gewerkschaften einen schweren Stand haben. Da gleichzeitig die Produktivität wegen des sehr robusten Wachstums der Investitionen stark wächst, sind die Lohnstückkosten, also die wichtigste Kostenkomponente, weiterhin unter Kontrolle – und mit ihr die Inflation. Wegen der meist kräftig steigenden Steuereinnahmen sind auch die Finanzminister nicht gerade unter Druck, die Steuern zu erhöhen oder die Ausgaben zu drosseln. Mit anderen Worten, sowohl die Haushalte als auch die Unternehmen haben keine Angst davor, dass die Wirtschaftspolitiker den Knüppel herausholen und der Konjunktur den Garaus machen könnten.
Schulden zu machen scheint in einem solchen („goldilocks“) Umfeld daher ziemlich risikolos zu sein. Die sehr niedrige und seit Jahren rückläufige Volatilität der Aktien, Renten und Wechselkurse zeigt, dass die Anleger zur Zeit kaum risikoscheu sind. Wenn wir nicht alle wüssten, dass sie sich da vertun werden!!
An manchen Rohstoffmärkten haben sich ebenfalls Blasen gebildet. Nachdem die Preise jahrzehntelang relativ zum allgemeinen Preisniveau, oder zum nominalen Sozialprodukt der Welt, gesunken waren und der Anreiz, neue Kapazitäten zu schaffen, gering war, haben wir es jetzt auf einmal mit Engpässen zu tun: Eine stark expandierende Nachfrage, ausgelöst durch die boomende Weltwirtschaft, trifft auf ein nur langsam zunehmendes Angebot. Ökonomen würden hier argumentieren, dass das sehr nach einem normalen Schweinezyklus aussieht und dass die hohen Preise, mit dem üblichen Time Lag, schon ein höheres Angebot hervorlocken werden, das dann die Preise wieder purzeln lässt. Wenn sich zudem herausstellen sollte, dass das Wachstum der Weltwirtschaft im Gefolge platzender Blasen niedriger ausfällt als bisher erwartet, kämen die Preise auch von daher unter Druck. Generell lässt sich sagen, dass es vermutlich da die größten Einbrüche geben wird, wo die relativen Preise am stärksten gestiegen sind. Insgesamt habe ich aber nicht den Eindruck, dass es gefährliche Dominoeffekte durch den möglichen Einbruch der Rohstoffpreise geben könnte. Sie könnten allerdings ein wesentliches und krisenverschärfendes Element bei einem globalen Assetpreis-Einbruch sein.
Einige Bondmärkte sind ebenfalls blasenverdächtig, wie beispielsweise die für Unternehmensanleihen. Die Anleger haben auf ihrer Jagd nach attraktiven Renditen eine solch starke Nachfrage nach diesen Papieren entwickelt, dass deren Spread zu risikolosen Staatsanleihen inzwischen dreimal oder viermal so niedrig ist wie vor fünf oder sechs Jahren. Niemand scheint Angst vor einer echten Rezession, einem nachhaltigen Rückgang der Gewinne oder einer Welle von Konkursen zu haben. Anleger halten die Wahrscheinlichkeit einer weltwirtschaftlichen Rezession offenbar für sehr gering. Sie glauben an so etwas wie den „Greenspan Put“, also daran, dass die entscheidenden Akteure der Wirtschaftspolitik über die Instrumente und den Willen verfügen, mit denen sie einen größeren Konjunktureinbruch verhindern werden.
Das hat Züge des Naiven. Indizien dafür, dass wir in Wirklichkeit in der Endphase eines Börsenbooms – und vor einer größeren Korrektur – sind, könnten die immer spektakuläreren Aktionen am Markt für sowohl feindliche als auch freundliche Fusionen und Unternehmensübernahmen sein. Es entsteht der Eindruck, dass Wasser in Wein verwandelt werden kann. Das hat es aber zuletzt vor 2000 Jahren gegeben und widerspricht der neueren ökonomischen Logik. Auf Dauer können die Erträge der Unternehmen nicht signifikant rascher zunehmen als das nominale BIP. Mit solch niedrigen Zahlen gibt sich aber zur Zeit niemand ab, so scheint es.
Der Markt für Credit Default Swaps, der seit Jahren explosionsartig expandiert, könnte ebenfalls die Illusion genährt haben, dass man sich gegen Risiken versichern kann und daher umso größere eingehen kann. Das mag mikro-ökonomisch hinhauen, auf der Makro-Ebene und im Weltmaßstab geht das nicht. Es fragt sich, welches Glied in der Kette der Risikoabwälzung zuerst wegbricht. Niemand hat auch nur die leiseste Ahnung. Schocks gibt es ja immer nur dort, wo man sie nicht erwartet – sonst wären sie ja keine Schocks.
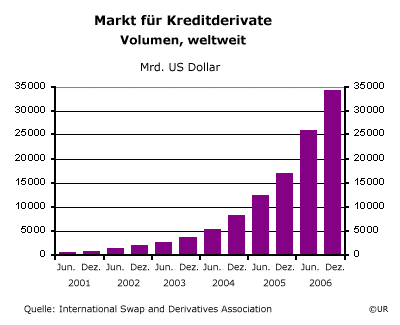
Es ist also zu empfehlen, gelegentlich auch mal Gewinne mitzunehmen und in sichere Anlagen umzuschichten. Gibt es die denn angesichts der vielen Blasen? Langlaufende Staatsanleihen europäischer Länder sind eine Möglichkeit, vielleicht auch, trotz der niedrigen Nominalzinsen, japanische und schweizerische. Bei ihnen lässt sich mit einiger Berechtigung auf eine Aufwertung ihrer unterbewerteten Währungen spekulieren.
Eine Bemerkung zum Schluss: Für jemanden, der für sein Alter eine kapitalgedeckte Rente aufbauen möchte, sieht es ziemlich eng aus. Die hohen Wertpapierkurse und meist teuren Immobilien bedeuten nichts anderes, als dass die künftigen Erträge mickrig sein werden (Deutschlands und Japans Immobilien dürften eine Ausnahme darstellen). Gut, dass wir noch das gute alte Umlageverfahren haben.