Am Mittwoch hatte die Fed beschlossen, bis Mitte 2011 monatlich für rund 75 Mrd. Dollar zusätzliche US-Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen zwei und zehn Jahren anzukaufen, netto insgesamt 600 Mrd. Dollar und brutto rund 800 Mrd. Dollar. Dabei deutete sie an, dass es bei Bedarf auch mehr sein könnten. Diese Zahlen entsprechen etwa 4 Prozent des amerikanischen, und 0,9 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (im dritten Quartal betrug das BIP der USA annualisiert 14,73 Billionen Dollar).
Es handelt sich also um ein massives Programm. Das vorangegangene vom Herbst 2008, als in Washington noch die Furcht vor einer Depression à la dreißiger Jahre umging, war allerdings etwa dreimal so groß. Inzwischen befindet sich Amerika offiziell allerdings seit mehr als einem Jahr im Aufschwung – daher die kleinere Dosis bei dieser Neuauflage des „quantitative easing„, auch QE2 genannt, wie das berühmte Schiff der Cunard Line.
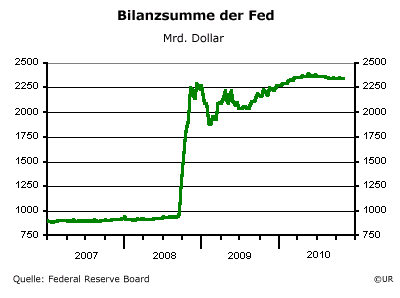
Was heißt das für die Märkte und für die Konjunktur in Amerika und im Rest der Welt? Ich versuche mal nachzuzeichnen, was mit dem Geld eigentlich passiert. Meine starke Vermutung ist, dass es sich um einen Fall von unintended consequences handelt. Niemand weiß, was wirklich passieren wird, und ob es die richtige Medizin ist.
Die Fed versucht, durch ihr Ankaufprogramm die Zinsen für längere Laufzeiten nachhaltig zu senken und dadurch die Ausgaben des Privatsektors zu stimulieren und neue Jobs zu schaffen. Auch nach den überraschend guten Arbeitsmarktzahlen für Oktober liegt die Beschäftigung („non-farm payrolls“) nämlich immer noch um 5,4 Prozent unter ihrem zyklischen Höchststand von Dezember 2007. Eigentlich müsste sie wegen des Bevölkerungswachstums jährlich um etwa 1 Prozent steigen, allein um einen Anstieg der Arbeitslosenquote zu verhindern. Wenn der Aufschwung nicht endlich kräftig Fahrt aufnimmt, wird es keine Vollbeschäftigung geben. Die Fed verfehlt damit auf eklatante Weise eines der beiden Ziele, die ihr von der Politik vorgegeben wurden.
Auch mit dem Inflationsziel hat sie Probleme: Statt 2 Prozent, wie angestrebt, liegen die Verbraucherpreise derzeit nur um 1,1 Prozent über ihrem Vorjahreswert. Noch beunruhigender ist, dass die sogenannte Kerninflationsrate, die ohne die erratischen Komponenten „Energie und saisonabhängige Nahrungsmittel“ berechnet wird, nur 0,8 Prozent beträgt und offenbar weiter fällt – sie gilt als Frühindikator für die Verbraucherpreisinflation insgesamt.
Die Fed ist also gehörig unter Druck. Auf einem anderen Blatt steht natürlich, ob sie mit ihrem Doppelmandat nicht völlig überfordert ist. Von der Finanzpolitik wird es auf absehbare Zeit keine Unterstützung geben. Die einzige verbleibende Hoffnung ist eine starke reale Abwertung des Dollar, weil dadurch sowohl die Inflation stimuliert als auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit verbessert würde. Das aber klar zu sagen, kann sie sich nicht leisten, weil das die Büchse der Pandora öffnen würde, also unabsehbare Folgen hätte. Trotzdem läuft die gegenwärtige Politik de facto notgedrungen darauf hinaus.
Die massive Zusatznachfrage nach Treasuries bewirkt, dass ihre Kurse steigen und die Zinsen sinken. Amerikanische Analysten schätzen, dass sich das Renditeniveau am langen Ende der Zinskurve um 75 Basispunkte vermindern wird. Manches davon ist in den vergangenen Wochen allerdings vom Markt schon vorweggenommen worden. Durch den Rückgang der Treasury-Renditen sinken aus Arbitragegründen auch die Zinsen, die private Schuldner zahlen müssen, beispielsweise für Hypothekenkredite und Unternehmensanleihen, was wiederum die Investitionstätigkeit und die Ausgaben insgesamt stimuliert. Dadurch entstehen neue Jobs und hoffentlich auch ein bisschen mehr Inflation. Ziele erreicht! So jedenfalls der Hauptgedanke.
Bei der Notenbank kommt es durch das Ankaufsprogramm auf der Aktivseite zu einem Anstieg der Forderungen gegenüber dem Staat (sie hält mehr Treasuries), auf der Passivseite zu einen analogen Anstieg der Einlagen von Banken. Die Bilanzsumme der Fed erhöht sich, die Menge an anlagesuchender Liquidität nimmt zu. Im Volksmund läuft dieser Prozess unter der Überschrift „Gelddrucken“. Bei gegebenem Geldmengenmultiplikator expandieren, so jedenfalls die Vorstellung, die sogenannten Geldmengenaggregate sowie das Kreditvolumen.
Die Reaktionen des Auslands auf diese Politik waren äußerst kritisch. Sie kamen vor allem aus Deutschland, China und Brasilien. Je größer das Angebot an Dollars, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Dollarabwertung. Was reichlich vorhanden ist, verliert an Wert. Die USA sind ein Akteur im gegenwärtigen Währungskrieg.
Solange es den amerikanischen Haushalten vor allem darum geht, ihre Schulden abzubauen und so ihre Bilanzen zu sanieren, lassen sie sich trotz der niedrigen Zinsen jedoch nicht so leicht dazu verleiten, neue Schulden aufzunehmen. Wohin also mit der zusätzlichen Liquidität? Das Ausweichen auf ausländische Wertpapiere ist fast zwangsläufig, zumal die Renditen in den USA sowohl am Rentenmarkt als auch am Aktienmarkt ziemlich niedrig sind.
Ob berechtigt oder nicht, QE2 gilt daher im Ausland als unfreundliche Geste. Zu dem Nettodollarangebot, das sich aus dem Leistungsbilanzdefizit von zur Zeit etwa 430 Mrd. Dollar pro Jahr ergibt, gesellt sich also möglicherweise noch ein Kapitalexport in ähnlicher Größenordnung. Um eine zu starke Aufwertung ihrer Währungen gegenüber dem Dollar zu verhindern und ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit zu wahren, sehen sich vor allem die Notenbanken der Schwellenländer gezwungen, diese gewaltigen Dollarmengen aufzukaufen, also Währungsreserven anzuhäufen. Das wiederum hat bei ihnen eine starke Geldmengenexpansion zur Folge. In China übertraf die Geldmenge M2 ihr Vorjahresniveau zuletzt um 19 Prozent, in Indien um 15,2 Prozent. Es fällt den Chinesen und Indern angesichts der Dollarflut schwer, gleichzeitig den Wechselkurs zum Dollar stabil zu halten und ihr Inflationsziel zu erreichen. Ein fester Wechselkurs bei höheren Inflationsraten ist nichts Anderes als eine (reale) Aufwertung gegenüber dem Dollar.
Dass der Euro in diesem Umfeld nicht viel stärker aufwertet – schließlich wird ja nicht interveniert -, hat allein damit zu tun, dass seine Überlebensfähigkeit immer wieder neu angezweifelt wird. Auf ihrer Pressekonferenz am Donnerstag hat die EZB noch einmal streng darauf hingewiesen, dass die vorgeschlagene Härtung der Maastrichter Verträge weit entfernt ist von dem, was nötig sei. Die Mechanismen, die eine konservative Finanzpolitik in allen Ländern der Währungsunion sicherstellen sollen, sind nach wie vor nur Absichtserklärungen. Es scheint fast, dass selbst die EZB nicht mehr fest an die Zukunft des Euro in seiner jetzigen Struktur glaubt. Immerhin hat diese wieder weit verbreitete Skepsis aber den situationsgerechten, genauer: den konjunkturgerechten Nebeneffekt, dass der Euro trotz eines relativ niedrigen (aggregierten) Staatsdefizits und einer fast ausgeglichenen Leistungsbilanz gegenüber Drittländern schwach ist.
Was die Effekte des „quantitative easing“ auf die amerikanische Finanzpolitik angeht, vermindert sie natürlich den Zwang, die Defizite radikal zu reduzieren. Die langen Zinsen sinken ja! Das ist anders als in Griechenland oder Irland, wo die Regierungen gar nicht anders können, als mitten in der größten Not ihre Gürtel noch enger zu schnallen, jedenfalls solange sie daran festhalten, ihre Schulden ordnungsgemäß zu bedienen.
Das neue Patt zwischen Präsident Obama und dem Kongress erschwert den Defizitabbau ohnehin. Dabei dürfte sich die Nettokreditaufnahme des Gesamtstaates laut Internationalem Währungsfonds im Jahr 2010 auf 11,1 Prozent des nominalen BIP belaufen (World Economic Outlook, Oct. 2010, S. 191). Ein zu aggressiver Defizitabbau wäre angesichts der rekordniedrigen Kapazitätsauslastung und einer Arbeitslosenquote von fast 10 Prozent das Gegenteil dessen, was aus konjunkturellen Gründen nötig ist: Zur Schwäche der privaten Nachfrage käme pro-zyklisch eine rückläufige Nachfrage der öffentlichen Hand. Der IWF schätzt übrigens, dass sich der Staatsverbrauch in diesem Jahr real um 1,5 Prozent erhöhen wird, was in etwa dem langfristigen Mittel entspricht (S. 179). Eine wirklich restriktive Finanzpolitik sieht anders aus.
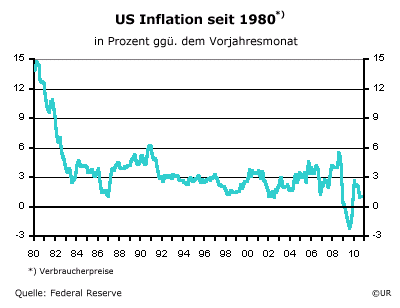
Noch ein Wort zu den Inflationsaussichten in Amerika. Die Rendite dreißigjähriger Treasuries beträgt 4,1 Prozent. Die Anleger gehen offenbar davon aus, dass die Inflation im Durchschnitt der nächsten 30 Jahre bei 1 1/2 Prozent liegen wird – ich nehme dabei an, dass das reale Sozialprodukt mit einer Trendrate von 2 1/2 Prozent expandiert. Mit anderen Worten: Trotz Budgetdefiziten, wie sie es in Friedenszeiten noch nie gab, und trotz der gewaltigen Aufblähung der Zentralbankgeldmenge sowie einem Zinsniveau nahe Null wird erwartet, dass die Inflation unterhalb des Zielwertes der Fed bleiben wird – und auf alle Fälle viel niedriger als in den vergangenen 30 Jahren. Es ist beängstigend. Entweder kommt es in den USA zu japanischen Verhältnissen, oder die Welt steckt schon wieder in einer Periode neuer Blasenbildungen und gefährlicher Ungleichgewichte. Es wird immer nur draufgesattelt – jedenfalls von Seiten Amerikas.