Die Finanzkrise hat eine Reihe von Problemen zutage gebracht, mit denen die Väter und Mütter des Euros nicht rechnen konnten. Das Hauptziel war es, die Inflation des Währungsraums insgesamt unter Kontrolle zu halten, also bei etwas unter 2 Prozent. So lautet das Inflationsziel der EZB. Das wurde erreicht, es stellte sich aber heraus, dass der Kampf gegen die Geldentwertung nur eine von mehreren Aufgaben der EZB ist, und in einer richtigen Krise nicht einmal die wichtigste. Es ist fast selbstverständlich, dass die Inflationsraten stark zurückgehen, wenn große schuldengetriebene Immobilien- und Aktienkrisen geplatzt sind oder Banken ihre Kredite zurückfahren, weil sie sich (mit Asset-backed Securities oder Hypothekenkrediten) verspekuliert haben.
Nicht nur das, es kann sogar Deflation drohen, also das Gegenteil von Inflation. Dieses Risiko muss mit aller Macht bekämpft werden. Das bedeutet zwangsläufig auch, dass die EZB versuchen muss, die Konjunktur durch möglichst niedrige Zinsen und eine generöse Versorgung mit Liquidität anzukurbeln oder in Schwung zu halten. Ihr im Maastrichter Vertrag festgeschriebenes Sekundärziel, die allgemeine Wirtschaftspolitik zu unterstützen, sobald Preisstabilität erreicht ist, rückt dadurch ganz nach oben auf der Prioritätenliste.
Wenn ich einmal kurz abschweifen darf: Genaueres über die Aufgaben der EZB finden sich in den europäischen Verträgen. In Artikel 127 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union heißt es „Soweit … ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich …, unterstützt das ESZB die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Union.“ Im Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union werden die wirtschaftspolitischen Ziele genannt: ausgewogenes Wirtschaftswachstum, Vollbeschäftigung und sozialer Fortschritt.
Es stellt sich aber auf einmal auch heraus, dass die EZB eine Schlüsselrolle bei der Stabilisierung, wenn nicht der Rettung des Bankensystems zu spielen hat. Für Ökonomen, die sich in der Geschichte des Geldwesens auskennen, ist das nicht überraschend – das war schon immer die Hauptaufgabe von Notenbanken. Nur wurde nicht gern darüber gesprochen, vor allem damit die Banken nicht in Versuchung geführt wurden. Sie wissen es natürlich: Wenn sie nur groß genug und systemrelevant sind, werden sie nicht untergehen. Sie können sich nicht nur billiger refinanzieren als die Konkurrenz, sie können auch größere Risiken eingehen und mehr Geld verdienen, wenn ihre Spekulationen aufgehen. Der Steuerzahler wird sie schon retten.
Das Thema war in den reichen Ländern in den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg weitgehend aus dem Bewusstsein der Ökonomen und der Öffentlichkeit verschwunden – im Vordergrund standen viele Jahrzehnte lang die Organisation des globalen Währungssystems und die Eindämmung der Inflation. In Artikel 119 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU werden „gesunde … monetäre Rahmenbedingungen“ aufgeführt, als einer von mehreren „richtungsweisenden Grundsätzen“, die eingehalten werden müssen. Das kann als ein vage formuliertes Mandat zur Sicherung der Finanzwesens angesehen werden – immerhin.
Obwohl es anders als in den USA oder Japan keine Zentralregierung als institutionellen Gegenpart zur Zentralbank gibt und die Rettung von Staaten, denen die Insolvenz droht, eigentlich Sache der anderen Mitgliedsländer der Währungsunion, oder höchstens noch des Internationalen Währungsfonds ist, betreibt die EZB de facto eine Rettungspolitik in eigener Regie, wenn auch nicht ganz freiwillig. Am offensichtlichsten in dieser Hinsicht sind die Ankäufe von europäischen Staatsanleihen seit Mitte Mai diesen Jahres von bislang 65,1 Mrd. Euro. Ob dadurch die Bilanzsumme der EZB verlängert wurde oder nicht, ist schwer zu sagen, weil die Ausweitung der Geldbasis durch diese Ankäufe möglicherweise durch eine Kürzung der (viel größeren) Geldmarktoperationen kompensiert wurde. In der Tat ist die EZB seit Juli dabei, die Ausleihungen an Banken kräftig zurückzufahren. Der Effekt der Anleihekäufe bestand vermutlich hauptsächlich darin, dass das Renditeniveau der Krisenmärkte zumindest zeitweise stabilisiert werden konnte und der Tag des Herrn erst einmal aufgeschoben wurde.
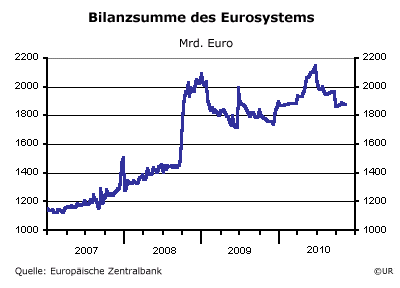
Daniel Gros von CEPS, dem Brüsseler Centre for European Policy Studies, argumentiert in einer Analyse vom 25. Oktober (CEPS Commentary: Liquidate or liquefy?) zu recht, dass die EZB auf ganz andere Weise viel größere Subventionen verteilt, indem sie nämlich den Banken in Griechenland, Irland, Portugal und Spanien , ebenso wie natürlich allen anderen Banken im Euroraum unlimitiert Geldmarktkredite einräumt, und zwar zu Zinsen, die weit unter den Werten liegen, die diese Banken am freien Markt unter Risikogesichtspunkten zahlen müssten. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB liegt bekanntlich seit Mitte Mai 2009 bei ein Prozent. Aus der folgenden Tabelle geht hervor, in welchem Umfang diese Mittel in den vergangenen Monaten beansprucht wurden.
| Notenbankkredite und Subventionen |
|||||
| Notenbankkredite an Kreditinstitute Mrd. Euro |
Notenbankkredite in Prozent der Einlagen |
Notenbankkredite in Prozent des BIP 2010 | EZB-Subvention im Jahr 2010 in % des BIP |
||
| August ’10 | Oktober ’10 | August ’101) | Oktober ’10 | ||
| Griechenland | 95,9 | 92,4 | 26% | 39,4% | 3,7% |
| Irland | 95,1 | 130,0 | 14% | 78,7% | 2,5% |
| Portugal | 49,1 | 40,0 | 15% | 23,4% | 2,9% |
| Spanien | 126,0 | 71,0 | 5% | 6,7% | 0,7% |
| 1) Daniel Gros (2010, S. 2) Quellen: Nationale Notenbanken, Bloomberg, eigene Berechnungen |
|||||
Die Verbindlichkeiten von Griechenlands Banken gegenüber dem Eurosystem beliefen sich im Oktober auf insgesamt 92,4 Mrd. Euro. Ich unterstelle, dass sie am freien Markt 9,48 Prozentpunkte mehr zahlen müssten, also 10,48 Prozent statt nur ein Prozent. Die Differenz entspricht dem Renditespread zwischen zweijährigen griechischen und deutschen Staatsanleihen. Letztere sind die sogenannte Benchmark, auf die sich alle anderen Märkte im Euroraum beziehen. Das bedeutet also, dass die griechischen Banken von der EZB – und damit von den 16 Ländern des Euroraums – eine jährliche Finanzspritze von 8,76 Mrd. Euro (92,4Mrd. Euro x 9,48/100) erhalten. Das entspricht 3,7 Prozent des diesjährigen Bruttosozialprodukts, unter der Annahme, dass es zwölf Monate bei den Spreads und den genannten Beträgen bleibt. Portugal und Irland werden ähnlich massiv subventioniert wie Griechenland, während Spanien auf deutlich weniger Hilfe angewiesen ist. Die Zahlen ändern sich täglich, vor allem die Marktzinsen, nicht aber die Größenordnung der Subventionen.
Indem die EZB die Zinsen, zu denen sich die Banken aus dem Eurogebiet bei ihr Geld leihen können, bei ein Prozent und damit nahe bei Null hält, ermöglicht sie Banken, die auf sich gestellt vermutlich kollabieren würden, zu überleben. Das ähnelt dem japanischen Modell. Bei Zinsen von nur ein Prozent fällt es recht leicht, auslaufende und eigentlich notleidende Kredite zu verlängern. Auf diese Weise entsteht ein Finanzsektor, der von sogenannten Zombie-Banks, auch Walking Dead genannt, bevölkert ist. Sehr niedrige Zinsen, die für eine lange Zeit beibehalten werden, verhindern den nötigen Strukturwandel und verursachen erhebliche volkswirtschaftliche Kosten, sind also wohlstandsmindernd.
Für die EZB bedeutet die Abhängigkeit der Banken von Billigkrediten der Notenbank, dass ihre Manövrierfähigkeit bei den Zinsen stark eingeschränkt ist. Gern würde sie ja die Zinsen erhöhen, aber wenn sie es täte, müsste sie womöglich in der nächsten Runde schon wieder Rettungsaktionen einleiten. Daher ist es verständlich, dass sie darauf drängt, dass möglichst rasch Klarheit darüber hergestellt wird, wie die Finanzierung der irischen Staats- und Bankenschulden organisiert werden soll. Sie möchte ihre Rolle als Retter in letzter Not endlich wieder loswerden und die Anzahl ihrer Freiheitsgrade erhöhen. Es ist schließlich nicht ihre Aufgabe, Strukturwandel zu verhindern.