Noch sind die deutschen Verbraucher und Unternehmer guter Dinge. Das ist ziemlich erstaunlich, denn die jüngsten Zahlen waren gar nicht so gut. Eine erneute Rezession ist nicht mehr auszuschließen. Die Arbeitslosigkeit stagniert in den fünf Monaten seit Januar saisonbereinigt bei 2,87 Millionen, auch wenn die Beschäftigung zumindest bis April Monat für Monat zugenommen hat – sie lag bei 41,55 Millionen und war damit um 1,4 Prozent höher als im April 2011. Der Arbeitsmarkt ist wegen der Kündigungsfristen und den zeitaufwendigen Einstellungsprozessen bekanntlich ein nachlaufender Konjunkturindikator und sagt daher kaum etwas darüber aus, wie es weitergehen wird. Insgesamt ist aber eine leicht negative Tendenz zu verzeichnen.
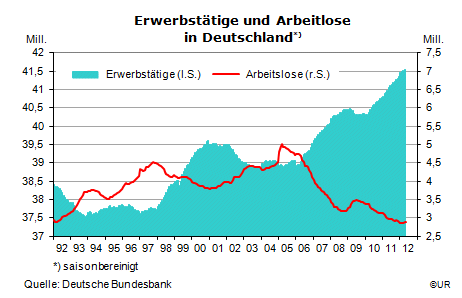
Ein wichtiger Frühindikator ist dagegen der reale Auftragseingang in der Industrie: Da gibt es nach dem kräftigen Rückgang im Sommer 2011 eine Stagnation. Im März und April waren die Aufträge um 2,4 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor. Das ist kein Einbruch, immerhin aber per Saldo ein Warnsignal. Es fehlt seit einiger Zeit an Wachstumsimpulsen. Die Aufträge aus dem Inland sind im Vorjahresvergleich in etwa genauso stark zurückgegangen wie die aus dem Ausland. Insgesamt sind die Aufträge in der Industrie immer noch um etwa ein Zehntel niedriger als im vierten Quartal 2007, dem letzten zyklischen Höhepunkt, kurz nach dem Beginn der globalen Finanzkrise.
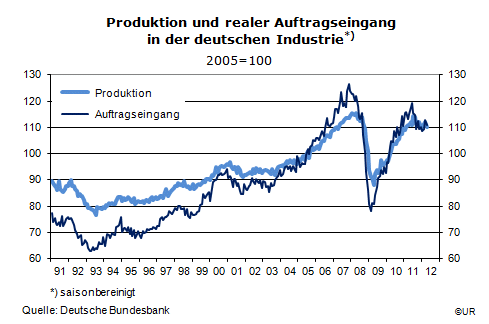
Den Unternehmen geht es nicht schlecht. Ihre Gewinne haben sich seit der Rezession von 2009 zügig erholt und haben das hohe Vorkrisenniveau fast schon wieder erreicht. Es gibt allerdings nur Daten bis zum ersten Quartal dieses Jahres. Immerhin zeigt der Geschäftsklimaindex des Ifo-Instituts, dass sich die Lage zwar seit vergangenem Sommer verschlechtert hat, aber auch zuletzt weit besser war als im langjährigen Durchschnitt. Nur dass sich die Erwartungen, vielleicht der wichtigste Frühindikator überhaupt, inzwischen in einem deutlichen Abwärtstrend befinden! Die Unternehmen sehen offenbar mit immer größerer Sorge, dass die Welt außerhalb der Grenzen aus dem Gleichgewicht zu geraten droht und es nicht ausgemacht ist, dass sie sich wie in der Vergangenheit darauf verlassen können, dass die Rettung aus dem Ausland kommen wird. Ihre Ausrüstungsinvestitionen waren jedenfalls schon in den beiden vergangenen Quartalen leicht rückläufig und lagen um knapp 10 Prozent unter den Spitzenwerten von 2007 und 2008.
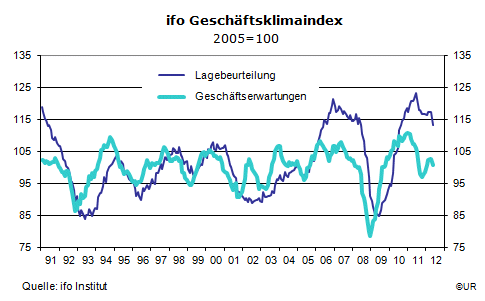
Ein kleiner Boom findet derweil am Bau statt. Während es in Spanien, Irland und Griechenland zu Immobilienblasen kam, gab es in Deutschland lange Jahre einen Rückgang der Bautätigkeit, der um die Mitte der nuller Jahre durch eine Stagnation abgelöst wurde. Das hatte den überraschend angenehmen Nebeneffekt, dass es keine Blase gab, die platzen konnte, und dass die Haushalte nicht überschuldet waren. Dass es in Deutschland dennoch bei den Banken Probleme mit Immobilien gab, war zum einen den Folgeproblemen des Booms nach der Wiedervereinigung geschuldet, als zu viel Geld in unrentable Projekte geflossen war, zum anderen aber ihrem leichtfertigen, um nicht zu sagen dummen Engagement im amerikanischen Markt, ihrer weitgehend unbeaufsichtigten und für den Steuerzahler letztlich enorm teuren Jagd nach Rendite.
Immerhin macht sich jetzt am Bau der aufgestaute Nachholbedarf bemerkbar. Auch der Staat hat begonnen, mit vollen Händen Geld auszugeben. Im ersten Quartal übertraf das reale Auftragsvolumen im Bauhauptgewerbe seinen Vorjahresstand um 9,6 Prozent. Das stabilisiert die Konjunktur, vor allem die Inlandsnachfrage. Leider ist der Anteil der Bauten an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung nur 9,9 Prozent.
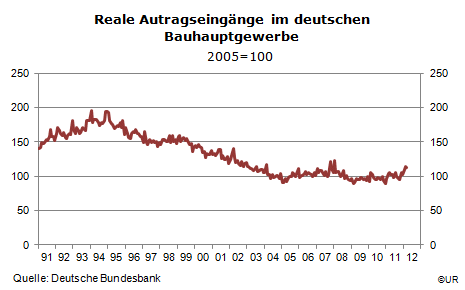
In der Industrie findet seit vergangenem Sommer bei der Produktion ein Abschwung statt; sie sinkt seitdem mit einer annualisierten Rate von etwa 6 Prozent. Ein Ende ist noch nicht in Sicht, da sowohl die Auftragseingänge als auch die Ifo-Indikatoren nach unten weisen. Es muss wegen der engen Korrelation mit der Industrieproduktion daher damit gerechnet werden, dass das reale BIP in den kommenden Quartalen bestenfalls stagniert. Ein Rückgang ist allerdings wahrscheinlicher. Sowohl bei der Industrie als auch beim Sozialprodukt wird sich die Output-Lücke wieder vergrößern. Das ist gut für die Stabilität des Geldwerts, aber ausgesprochen schlecht für die Beschäftigung.
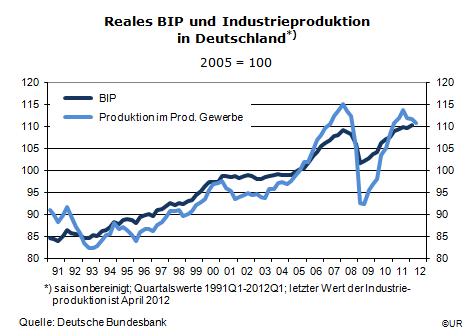
Gut dass es den Euro gibt! Seine Abwertung ist wie ein Konjunkturprogramm. Wenn Deutschland auf sich gestellt wäre, so etwa wie die Schweiz heute, wäre der Wechselkurs wegen der relativ robusten Konjunktur und der gewaltigen Überschüsse im Außenhandel bombenfest: Es könnte viel weniger exportiert werden als heute, und das Land wäre immer noch der kranke Mann Europas. Ohne Eurokrise wäre der Euro nicht so schwach wie er ist, und es käme vor allem auf die Inlandsnachfrage an. Die lahmt meistens.
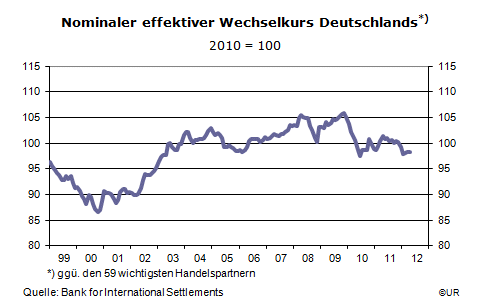
Der andere große Vorteil des Euro besteht darin, dass er der Bundesrepublik nicht nur ein außerordentlich niedriges Zinsniveau beschert hat – da der „deutsche“ Euro als Fluchtwährung gilt –, sondern auch eine sehr flache Renditekurve. Die Differenz zwischen langen und kurzen Zinsen ist immer noch positiv, aber der Abstand zwischen den Fristen hat sich zuletzt dramatisch vermindert. 30-jährige Bundesanleihen bringen heute nur noch 1,90 Prozent Zinsen, 10-jährige 1,33 Prozent, während 3-Monatsgeld unter Banken bei 0,58 Prozent liegt; der Bund ist mit seinen dreimonatigen „BuBills“ bei -0,01 Prozent angelangt. Je flacher die Renditekurve, desto größer ist der geldpolitische Impuls für die Konjunktur, und umgekehrt gilt das auch. Im Allgemeinen stimuliert eine flache Zinskurve die Kreditvergabe an den privaten Sektor, und damit die gesamtwirtschaftliche Nachfrage. Real sind jetzt außerdem selbst die sehr langfristigen Renditen leicht im Minusbereich, sodass von daher ebenfalls ein Anreiz besteht, weniger zu sparen. Oder? In Japan habe ich mal das Argument gehört, dass die niedrigen Zinsen der „sicheren“ Staatsanleihen die Leute zwingen, erst recht möglichst viel zu sparen, damit sie im Alter von den Zinseinkünften einigermaßen gut leben können.
Was die Konjunktur angeht, sind niedrige Zinsen besser als hohe, aber für sich genommen stimulieren sie die Nachfrage keineswegs. Es muss einerseits die Bereitschaft da sein, sich zu verschulden, also eine gewisse Risikobereitschaft und Bonität, zum anderen müssen die Banken bereit sein, ihre Bilanzen zu verlängern – wenn ihr oberstes Ziel aber darin besteht, die Eigenkapitalquoten zu erhöhen, wird es trotz niedriger Zinsen nichts mit der Kreditexpansion. So aber sieht es heute aus.
Es gibt noch einen weiteren expansiven Effekt: den rückläufigen Ölpreis und die rückläufigen Preise der übrigen Rohstoffe. Seit zweieinhalb Monaten sinken daher die Einfuhrpreise, während die Ausfuhrpreise stagnieren. Anders ausgedrückt, die Preise für das, was in Deutschland verbraucht wird, steigen langsamer als die Preise für das, was produziert wird. Noch anders ausgedrückt heißt das, dass die Kaufkraft der Haushalte zunimmt. Da gleichzeitig, wie erwähnt, die Anzahl der Jobs erstaunlicherweise weiter zunimmt und die Lohnsteigerungen neuerdings so hoch ausfallen, dass auch real etwas übrig bleibt, sind die Voraussetzungen dafür gegeben, dass der private Verbrauch ganz gut laufen wird. Das wäre mal was!
Insgesamt spricht nichts dagegen, dass die deutsche Regierung positiv auf die Forderungen der übrigen Euroländer nach mehr Wachstumspolitik reagieren sollte. Der Zinsvorteil durch den Status des Landes als „safe haven“ ist etwa zwei Prozentpunkte des Sozialprodukts wert, der sich für expansivere Maßnahmen nutzen ließe. Auch die große, und jetzt wieder größer werdende Output-Lücke legt nahe, dass der Staat ohne Risiken für Inflation und Kreditwürdigkeit erheblich mehr für die inländische Nachfrage – und damit auch für die Importe – tun kann. Eine robustere deutsche Konjunktur ist neben den überfälligen Änderungen der institutionellen Rahmenbedingungen im Euro-Raum das Beste, was sich für den Fortbestand des Euro tun lässt.