Manchmal beschließen Politiker beinahe nebenher Sachen, über deren umwälzende Effekte sie sich keine Vorstellung machen. Das war so bei der Wiedervereinigung, als die DDR-Führung fast aus Versehen den freien Reiseverkehr gestattete, was dann umgehend zum Fall der Mauer und des europäischen Kommunismus führte, das war so bei der Gründung der Währungsunion, als sich die Politiker Italiens, Spaniens und anderer Schwachwährungsländer nicht darüber im Klaren waren, wie sehr sie ihre Politik in einem System unveränderbarer Wechselkurse würden umkrempeln müssen, und es war am 13. Dezember nicht viel anders, als die Finanzminister der 17 Euroländer der gemeinsamen Bankenaufsicht, dem sogenannten Single Supervisory Mechanism SSM unter der Ägide der EZB, überraschend schnell grünes Licht gaben.
Es war de facto der vielleicht nicht von Allen gewollte Einstieg in eine europäische Bankenunion. Nach Berechnungen von Nicolas Veron vom Brüsseler Think Tank Bruegel wird die neue Aufsichtsbehörde direkt für eine Gruppe großer und wichtiger Banken zuständig sein, auf die rund 80 Prozent der Bankaktiva im Euroraum entfallen. Auch beim Rest (also etwa den deutschen Sparkassen) wird sie ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben – wie genau das aussehen wird, ist allerdings noch auszuhandeln.
Wer für eine Aufsicht mit Biss ist, und das waren am 13. Dezember offenbar alle, der muss auch bereit sein, ihr unpopuläre und kostspielige Entscheidungen zu ermöglichen. Wenn die Behörde eines vermutlich nicht allzu fernen Tages zu dem Schluss kommen sollte, dass eine oder mehrere Banken nicht überlebensfähig sind, mit den finanziellen Mitteln ihrer Heimatländer aber nicht zu sanieren sind, dann wird sich nicht vermeiden lassen, sie in irgendeiner Form mit Mitteln aus einem gemeinsamen Topf zu retten oder zu schließen. Das gilt vor allem für Länder der Peripherie, die schon jetzt so hoch verschuldet sind, dass sie keinen Zugang zum Kapitalmarkt haben.
In der Schlusserklärung zur Sitzung vom 13. Dezember betont der Ministerrat zwar, dass die Steuerzahler in solchen Fällen nicht zur Kasse gebeten werden sollten – die Sanierungs- und Abwicklungsbehörde (nennen wir sie SAB) soll nämlich durch den Bankensektor selbst finanziert werden. Da es aber ohne einen wirksamen „backstop“ nicht gehen dürfte, ist der europäische Steuerzahler dann im Ernstfall doch gefragt, wenn auch nur, so die Hoffnung, durch die Vergabe von Krediten. Der Bankensektor würde dann später die Lasten wieder abtragen müssen, und zwar indem er Gebühren an die SAB abzuführen hätte.
Für’s Erste stehen solche Entscheidungen vermutlich noch nicht an, angesichts der lausigen Qualität vieler Bankaktiva und der anhaltend tiefen Rezession in Ländern wie Italien und Spanien ist es aber nur eine Frage der Zeit. Was passiert, wenn eine der dortigen Großbanken so viel abschreiben muss, dass ihr Eigenkapital weg ist, ein ungeordneter Konkurs wegen der unabsehbaren Folgen aber unter allen Umständen vermieden werden soll? Am plausibelsten scheint mir, dass dann die EZB, zusammen mit dem ESM-Rettungsschirm, einspringen wird. Da der ESM rasch an seine finanziellen Grenzen stoßen dürfte und es dann lange dauern dürfte, bis zusätzliche Mittel mobilisiert werden können, nicht zuletzt wegen des Widerstands des Bundestags, wird die EZB letztlich der lender of last resort sein und das nötige Geld bereitstellen. Die Notenbank wäre zwangsläufig der sogenannte fiscal agent der 17 Finanzminister – womit wir nicht nur de facto bei einer Bankenunion, sondern bei der Fiskalunion wären, ohne die die Währungsunion sowieso auf Dauer nicht überleben kann.
Nur für die EZB gibt es in finanzieller Hinsicht keine Begrenzungen. Seit dem Beginn der Finanzkrise im Sommer 2007 ist die Bilanzsumme des Eurosystems von 1,2 auf 3,0 Billionen Euro gestiegen, also um 150 Prozent, ohne dass sich die Inflation beschleunigt hätte.
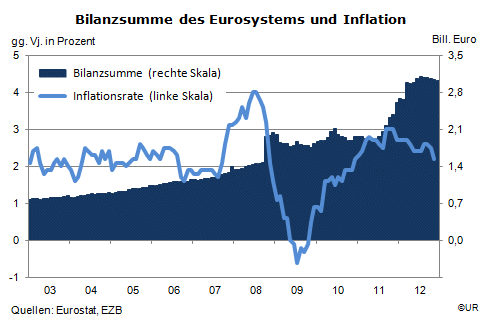
Solange die Finanzkrise anhält und Schuldenabbau bei privaten und staatlichen Haushalten ebenso wie bei Banken Priorität hat, bleibt der monetäre Transmissionsmechanismus gestört. Weniger technisch ausgedrückt: Die EZB kann Gas geben wie sie will, aber leider ist die Kupplung kaputt. Das lässt sich beispielsweise daran ablesen, dass die Bankkredite an den privaten Sektor in den vergangenen Monaten trotz der forcierten Expansion der Zentralbankgeldmenge weiterhin niedriger waren als vor einem Jahr.
Wie der Europäische Rat, argumentiert auch die EZB in ihrem jüngsten Financial Stability Review (S. 124f), dass eine gemeinsame Aufsicht ohne eine gemeinsame und von den nationalen Regierungen unabhängige Sanierungs- und Abwicklungsbehörde nicht sinnvoll ist. Sie gehören zwangsläufig zusammen.
Es kann ja nicht sein, dass die zentrale, bei der EZB angesiedelte Aufsicht empfiehlt, eine Bank zu schließen, es dann aber dem betroffenen Land überlässt, die Folgekosten zu tragen, zumal das im Einzelfall oft gar nicht möglich ist. Die EZB – und der ESM – würden sich dann finanziell nicht heraushalten können. Sich darauf zu verlassen, wäre für die Regierungen allemal leichter, als ihre Steuerzahler und die Gläubiger der Krisenbanken zur Kasse zu bitten.
Wenn dieser Ausweg einmal institutionalisiert wäre, entfiele aus Sicht der EZB der Zwang, radikale aber notwendige Maßnahmen zu ergreifen, also den Bankensektor rasch zu sanieren. Ein solcher Rettungsmechanismus kann nicht gewollt sein. Deshalb: Wer A sagt (zentrale Aufsicht), muss auch B sagen (gemeinschaftliche Sanierung und Abwicklung). Das hätte zudem den entscheidenden Vorteil, dass der nationale Schuldenabbau nicht unnötig durch die Kosten von Bankenrettungen behindert wird. Ich denke, dass das so naheliegend ist, dass es zwangsläufig dazu kommen wird.
Das sehen nicht alle so. Wolfgang Münchau hat kürzlich in der Financial Times argumentiert, dass Angela Merkel nie bereit sein wird, den deutschen Steuerzahler direkt oder indirekt für die Rettung von Banken anderer Leute zahlen zu lassen – sie ist erklärtermaßen gegen eine Vergemeinschaftung der Schulden und verdeckte Transfers in die Krisenländer. Ich stimme zu: Das „Nie“ ist wohl ernst gemeint. Aber ich bezweifle, dass das auch für die Zeit nach den Bundestagswahlen gilt, oder in einem Notfall, wenn die Existenz des Euro selbst auf dem Spiel steht.
Grundsätzlich bin ich auch davon überzeugt, dass die deutschen Steuerzahler Maßnahmen gutheißen werden, durch die Eurokrise und Wachstumsschwäche überwunden werden könnten. Ein schlüssiges Konzept, wie der europäische Bankensektor wetterfest gemacht werden kann, ist dafür eine entscheidende Voraussetzung. Wenn die „Kosten“ von einer neuen gemeinsamen Institution getragen würden (mit Zugang zu den Mitteln der EZB), müsste es ihnen im Grunde recht sein. Es sollte ihnen allerdings klar gemacht werden, dass das „Gelddrucken“ nicht unbedingt so gefährlich ist, wie das in den Medien immer dargestellt wird: Angesichts der Unterauslastung der gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten sind die Inflationsrisiken gering – und sie sind beherrschbar. Da muss in Deutschland noch so mancher vom Saulus zum Paulus werden.
Im Vergleich zu dem, was gegenwärtig an Monetisierung der Staatsschulden in den USA, in Japan und in Großbritannien getrieben wird, ist die EZB bislang außerordentlich konservativ. Die indirekte Finanzierung einer Sanierungs- und Abwicklungsbehörde (letztlich einer Abteilung eines künftigen Finanzministeriums der EU17) unterschiede sich nicht qualitativ von dem, was dort geschieht. Außerordentliche Krisen erfordern außerordentliche Maßnahmen, auch wenn die aus deutscher Sicht wie Sünden wider den heiligen Geist erscheinen. Aber mal ernsthaft: Wo sind denn die Inflationsrisiken? Und was ist schlecht daran, wenn wir uns wieder Gedanken darüber machen, wie sich der Wohlstand mehren lässt, statt immer nur darüber, wie unsere Brüder und Schwestern im lateinischen Teil des Kontinents ihre Gürtel noch enger schnallen können?