Ich habe in den vielen Jahren, in denen ich versucht habe zu verstehen, warum die Wechselkurse sich bewegen wie sie sich bewegen, gelernt, dass von den ökonomischen Faktoren, die für eine Erklärung in Frage kommen, auf Dauer die Veränderungen in den Salden der Leistungsbilanzen am verlässlichsten sind. Unter den europäische Währungen wertete die D-Mark früher stets auf, während die Lira und der französische Franc fast immer abwerteten – Deutschland hatte einen Überschuss in der Leistungsbilanz, die beiden anderen Länder ein beinahe strukturelles Defizit. Auch der Dollar gehörte, und gehört, zu den abwertenden Währungen. Dass es bisher nicht zu einer Flucht aus dem Greenback gekommen ist, hat vor allem mit seinem Status als Reservewährung und Zielwährung für Fluchtkapital zu tun.
Inzwischen müssen wir uns daran gewöhnen, dass der Euro so etwas die neue D-Mark ist. Aufgrund der relativ restriktiven Finanzpolitik und seiner unterausgelasteten Kapazitäten, einschließlich des Arbeitsmarkts, generiert Euroland Leistungsbilanzüberschüsse. In den vergangenen zwölf Monaten belief sich der positive Saldo der Leistungsbilanz auf nicht weniger als 247 Mrd. Euro; das waren 2,6 Prozent des nominalen BIP. Noch nie, und nirgendwo sonst, hat es in absoluten Zahlen gerechnet einen so großen Überschuss gegeben. China, die Nummer 2 in dieser Hinsicht, kommt auf einen Überschuss von 136 Mrd. Euro oder 1,7 Prozent seines BIP. Das Defizit der USA liegt dagegen zurzeit bei rund 2,1 Prozent des BIP. Ich bin daher nicht darüber erstaunt, dass der Euro so fest ist, sondern darüber, dass er nicht viel fester ist. Zum Glück, kann ich nur sagen, wenn ich mir ansehe, wie viel Deflationspotenzial es ohnehin schon gibt. In Japan kam es abgesehen von den Effekten des „deleveraging“ nach den geplatzten Aktien- und Immobilienblasen der achtziger Jahre nicht zuletzt deswegen zu einer jahrzehntelangen Deflation, weil der Yen wegen der riesigen Leistungsbilanzüberschüsse ständig aufwertete, also zusätzliche Deflation importiert wurde. Erst im Jahr 2012 war Schluss damit: mit den Überschüssen, dem festen Yen und der Deflation.
Ich habe im Folgenden mal empirisch, wenn auch nur mit einer sehr beschränkten Datenmenge, überprüft, ob sich meine Behauptung halten lässt, dass es vor allem auf die Leistungsbilanz ankommt. Die Datenbasis, die ich verwendet habe, ist jedermann zugänglich und wird jede Woche auf den neuesten Stand gebracht: Sie findet sich auf einer der hinteren Seiten im Economist. Die folgende Tabelle ist ein Auszug aus der Ausgabe vom 26. April dieses Jahres. Die Leser können sie für sich herunterladen, wenn sie nachvollziehen wollen, was ich (genauer: mein Co-Blogger Uwe Richter) so gerechnet habe.
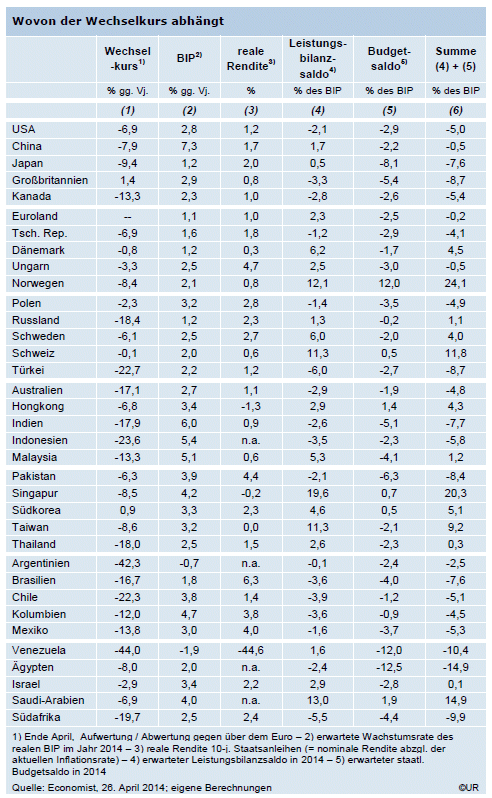
Bei den fünf folgenden Regressionsanalysen ist die abhängige Variable die Veränderung der Wechselkurse gegenüber dem Euro (Spalte 1 der Tabelle; da Argentinien und Venezuela als Ausreißer nicht berücksichtigt werden, verbleibt eine Stichprobe von 32 Ländern). Als erklärende ökonomische Variable verwende ich die für 2014 erwartete Zuwachsrate des realen BIP, die aktuelle reale Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sowie die für 2014 erwarteten Salden in der Leistungsbilanz und im Staatshaushalt. Ich habe auch getestet, ob so etwas wie die aggregierten „twin deficits“ irgendetwas zur Erklärung der Wechselkurse hergeben. Alles sehr simpel, nach dem Motto, was sich nicht mit einfachen Mitteln erklären lässt, ist vermutlich falsch. Den Nobelpreis für volkswirtschaftliche Methodenlehre strebe ich nicht an. (In den folgenden Schaubildern ist jeweils die geschätzte Regressionsgerade und das Bestimmtheitsmaß (R2) angegeben, sowie das Signifikanzniveau, bei dem die Hypothese, dass der Koeffizient der erklärenden Variable gleich Null ist, diese also keinen Einfluss auf den Wechselkurs hat, verworfen werden kann. Als statistisch signifikant verschieden von Null gelten Koeffizienten üblicherweise, wenn das Signifikanzniveau kleiner als 0,05 ist.)
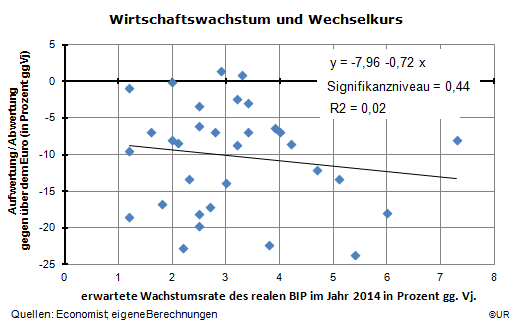
Das erste Schaubild zeigt, dass es keinen Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Wechselkurs gibt – höchstens einen leicht negativen: Die Währungen der Länder, die stärker wachsen, werten der Tendenz nach etwas stärker ab als die anderen. Eigentlich hätte man das Gegenteil erwartet: Dynamische Länder sind Ziel von Kapitalzuflüssen, vor allem an den Aktienmarkt und den Immobilienmarkt, auch weil die realen kurzfristigen Zinsen vergleichsweise hoch sein dürften. Versuch einer Erklärung, warum das nicht zu erkennen ist: Oft kommt es bei rasch wachsenden Ländern zu relativ hohen Lohnsteigerungen und Inflationsraten, so dass sie an Wettbewerbsfähigkeit verlieren, worunter die Leistungsbilanz und damit die Nachfrage nach der Währung leidet.
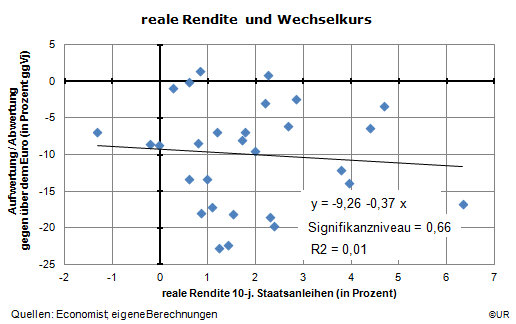
Nach dem zweiten Schaubild gibt es auch zwischen realer Bondmarktrendite und Wechselkurs keinen Zusammenhang. Länder, die als solide gelten, sind Ziel von Kapitalzuflüssen; ihre Währungen werten auf und die Realzinsen sinken. So die Theorie. Im wirklichen Leben führen hohe Realzinsen offebar nicht zu einer Aufwertung. Ich vermute sogar eine umgekehrte (aber höchstens schwache) Kausalität: Weil es zu Kapitalzuflüssen kommt, sinken die Realzinsen, die Währung aber wertet auf.
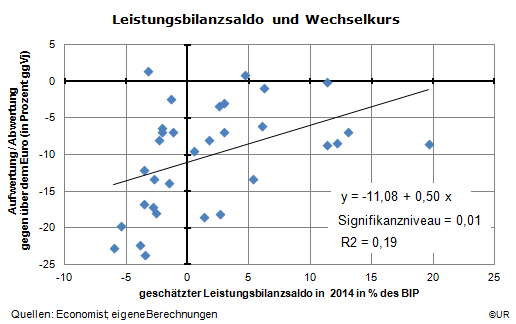
Zwischen Leistungsbilanz und Wechselkurs gibt es den erwarteten Zusammenhang: Währungen von Ländern, die aus konjunkturellen oder strukturellen Gründen Überschüsse in der Leistungsbilanz aufweisen, sind tendenziell fest. Der Euro gehört dazu, ebenso wie der Schweizer Franken oder die schwedische Krone. Länder mit Überschüssen sind nicht auf Kapitalimporte angewiesen und gelten meist als robust, krisenresistent und ceteris paribus als „safe havens“. Wenn Wechselkurse gegenüber dem Euro oder – häufiger – gegenüber dem Dollar fixiert sind oder in einem engen Band gehalten werden, muss grundsätzlich damit gerechnet werden, dass sich diese Bindung eines Tages nicht mehr halten lässt und es zu Aufwertungen kommt; das Umgekehrte gilt für Währungen von Ländern, die Defizite in der Leistungsbilanz aufweisen.
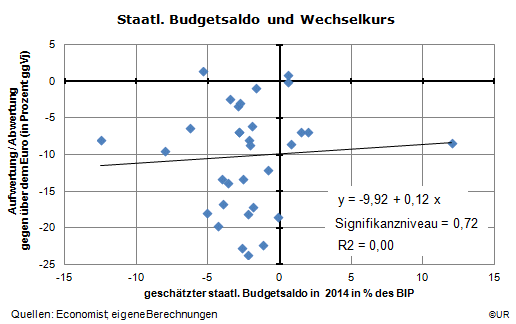
Der staatliche Haushaltssaldo hat, soweit sich das aufgrund der schmalen Datenbasis sagen lässt, so gut wie gar nichts mit der Veränderung des Wechselkurses zu tun. Er hat kaum Effekte auf die Nachfrage und das Angebot von Währungen am Devisenmarkt. Es wäre vielleicht zu erwarten gewesen, dass Länder mit hohen Defiziten mit Netto-Kapitalabflüssen zu kämpfen haben – und damit mit Abwertungen –, aber das lässt sich statistisch nicht belegen. Es könnte einen anderen Zusammenhang geben: Hohe staatliche Defizite gelten bei Wählern in der Regel als nicht akzeptabel, so dass sich Regierungen meist bemühen, sie abzubauen. In der Folge sinken die Risikoprämien sowohl bei Aktien als auch insbesondere bei längerfristigen Staatsanleihen. Das wiederum verspricht Kursgewinne und führt damit zu Kapitalzuflüssen.
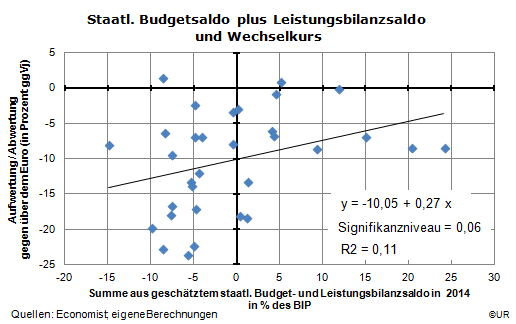
Im letzten Schaubild habe ich mal geprüft, ob die „twin deficits“ eine größere Rolle für den Wechselkurs spielen als jedes der beiden Defizite für sich allein – oder, umgekehrt, die „twin surpluses„. Da die Budgetsalden de facto irrelevant sind, ergibt die Addition der beiden Salden keinen Erkenntnisgewinn – so naheliegend die Vermutung auch ist, dass die Wechselkurse von besonders „unsoliden“ Ländern stärker abwerten als die von Ländern, die nur eins der beiden Defizite aufweisen.
Es zeigt sich, dass statistisch gesehen allein der Leistungsbilanzsaldo eine Erklärung für die Bewegung des Wechselkurses liefert. Es sind aber fast immer noch andere Faktoren mit im Spiel. Einige Beispiele:
- Chinas Yuan müsste aufgrund der Fundamentaldaten gegenüber dem Dollar ständig aufwerten und gegenüber dem Euro stabil sein; stattdessen hat er sich seit Mitte 2013 gegenüber beiden Währungen abgewertet; das ist von der Regierung offenbar gewollt, weil sich die preisliche internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht weiter verschlechtern soll; insbesondere Japan hat ja zur Reflationierung seiner Wirtschaft so etwas wie einen Währungskrieg angezettelt („Abenomics“).
- Auch der Rubel müsste sehr fest sein, wenn es nur auf die Ökonomie ankäme – tut es aber nicht. Kapitalflucht bestimmt seit mehr als einem Jahr das Bild, zuletzt noch einmal angeheizt durch die gefährliche Annektionspolitik der russischen Regierung. Ich vermute, dass der Rubel kräftig aufwerten wird, wenn die Krise in der Ukraine eines Tages auf friedliche Weise beigelegt ist.
- Die Währungen von Dänemark und der Schweiz sind wegen der riesigen Überschüsse in den Leistungsbilanzen dieser Länder Aufwertungskandidaten; durch Interventionen am Devisenmarkt werden sie gegenüber dem Euro in einem engen (Festkurs-)Band gehalten. Euroland ist für beide der bei Weitem wichtigste Partner im Handel und Kapitalverkehr; sie sind de facto Teile von Euroland. Solange sie nichts gegen die Beschlüsse der EZB einzuwenden haben und so lange die Eurokäufe keine Inflationsspirale auslösen, wird es bei den festen Kursen bleiben.
- Hongkong, Singapur, Taiwan und Saudi-Arabien haben ihre Währungen de facto an den Dollar gebunden; ihre gewaltigen Leistungsbilanzüberschüsse sprechen dafür, dass ihre Währungen stark aufwerten werden, wenn diese Bindung einmal aufgegeben werden sollte.
- Das Pfund Sterling ist ein Phänomen: Die Inflation ist hoch, das Loch in der Leistungsbilanz ist riesig und die Staatsfinanzen in schlechter Verfassung – dennoch ist die Währung fest. Großbritannien profitiert offenbar von Fluchtkapital aus aller Herren Länder. Es macht nichts, dass es im Außenhandel und damit in der Industrie große Probleme gibt, so lange es gelingt, überteuerte Immobilien und Fußballclubs an reiche Ausländer zu verkaufen.
Insgesamt brauche ich mein Vorurteil nicht zu revidieren, dass es beim Wechselkurs wesentlich auf den Saldo der Leistungsbilanz ankommt. („It’s the current account, stupid„, um mal einen zeitlosen Spruch von Bill Clinton abzuwandeln). Soweit das die Daten, die ich hier verwendet habe, hergeben, spielt er im Gegensatz zum BIP-Wachstum, den realen Bondmarktrenditen oder der Situation der öffentlichen Haushalte eine bedeutende Rolle. Aber nicht-ökonomische Faktoren sind oft mindestens so wichtig, beispielsweise politische Ereignisse, die zu Kapitalflucht führen, Devisenmarktinterventionen und zinspolitische Maßnahmen mit dem Ziel, einen bestimmten Wechselkurs zu verteidigen oder zu etablieren, vermutlich auch verbale Interventionen wie die von Mario Draghi, dass die EZB alles tun werde, um den Euro zu stabilisieren. Mit einer einfachen Formel lassen sich Wechselkurse nicht vorhersagen.