Auf absehbare Zeit gibt es kaum etwas, was den Höhenflug des Dollar beenden könnte. So erfreulich das angesichts der niedrigen Kapazitätsauslastung aus deutscher und europäischer Sicht ist, so gefährlich ist es für das internationale Finanzsystem. Darauf hat die BIZ, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, in ihrem neuen Quarterly Review hingewiesen: Während die staatlichen Schuldner in den Schwellenländern nach den Krisen der achtziger und neunziger Jahre in letzter Zeit nur geringe Dollarschulden aufgenommen hatten, war der private Sektor umso aktiver. Die Unternehmen dieser Länder hatten in den vergangenen Jahren 2,6 Billionen Dollar an Fremdwährungsanleihen begeben; hinzu kamen bis Mitte 2014 rund 3,1 Billionen Dollar an internationalen Bankkrediten. Etwa drei Viertel dieser Verbindlichkeiten, insgesamt also nicht weniger als 4,3 Billionen Dollar, dürften auf Dollar lauten. Zum Vergleich: Das BIP der Welt schätzt der Internationale Währungsfonds für 2014 auf 77,6 Billionen Dollar. Der springende Punkt ist, dass sich die Schulden, in nationaler Währung gerechnet, im Verlauf der Dollaraufwertung stark erhöht haben und es daher zunehmend fraglich ist, ob sie pünktlich bedient werden können. Wenn es mit dem Dollarkurs so weitergeht wie in diesem Jahr, dürfte bald die nächste globale Finanzkrise ins Haus stehen.
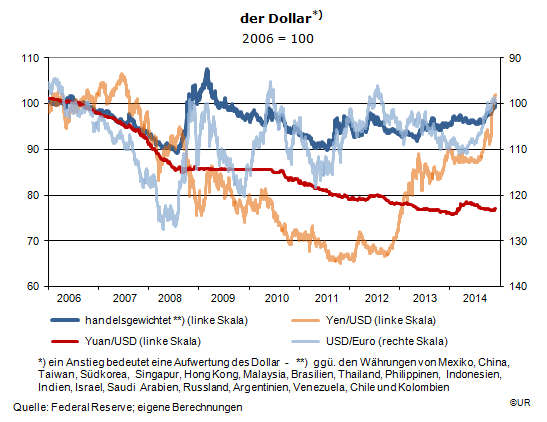
In den USA wird eine Trendwende in der Geldpolitik immer wahrscheinlicher. Das quantitative easing ist bereits eingestellt worden. Was spricht noch für Leitzinsen von nahe Null, wenn die Beschäftigung mit Raten von zwei Prozent zunimmt, die Arbeitslosenquote auf 5,8 Prozent und damit fast auf Normalniveau gesunken ist, das reale BIP seit dem Frühjahr annualisiert mit einer Rate von 4,25 Prozent steigt und die Inflation sich der magischen Marke von zwei Prozent nähert (von unten, wohlgemerkt!)? Die Fed braucht auch keine Rücksicht mehr auf den Zustand der öffentlichen Finanzen zu nehmen, da das Haushaltsdefizit rascher zurückgeht als erwartet und inzwischen nicht mehr als Problem angesehen wird. Natürlich ist die Leistungsbilanz nach wie vor stark defizitär, was für sich genommen an den Devisenmärkten ein Überangebot an Dollar bedeutet und für einen schwachen Wechselkurs spricht, die autonomen Zuflüsse in die amerikanischen Kapitalmärkte kompensieren diesen Effekt aber locker.
Insgesamt spricht zurzeit alles für den Greenback. Weder die europäische Währungsunion noch Japan befinden sich in einer ähnlich günstigen Lage wie die USA: Ihre Wirtschaft stagniert, so dass sich die Outputlücken einfach nicht schließen wollen, aus Inflation droht Deflation zu werden, und die Notenbanker sinnen auf weitere expansive Maßnahmen, vor allem wie sie ihr Geldangebot massiv erhöhen können. Der Yen ist besonders unter Druck, weil die Leistungsbilanz Japans erstmals seit Jahrzehnten ins Defizit gerutscht ist. Selbst China, nach wie vor die Lokomotive der Weltkonjunktur, verliert zusehends an Dynamik; Anleger sind sich zudem nicht sicher, ob es nicht doch zu Überinvestitionen gekommen ist, vor allem in den Bereichen Infrastruktur und Immobilien, die nach einer Korrektur verlangen. Jedenfalls schwächelt neuerdings sogar der einst superfeste Renminbi.
Es ist nicht zu erkennen, dass die europäischen, japanischen oder chinesischen Währungsbehörden irgendein Interesse daran haben, die Aufwertung des Dollar zu bremsen. Zinserhöhungen und Dollarverkäufe kommen nicht infrage. Ganz im Gegenteil, die Schwäche ihrer Währungen ist genau das, was ihnen ein Arzt in der gegenwärtigen Situation verschreiben würde. Andererseits nehmen die amerikanischen Wirtschaftspolitiker die Stärke des Dollar gelassen, wenn nicht sogar erfreut zur Kenntnis; sie bremst nicht nur den Anstieg der Inflationsraten, sondern verhindert darüber hinaus, dass der Zinsanstieg am langen Ende der US-Renditekurve zu rasch vonstattengeht; das vermindert den Abschreibungsbedarf auf die Bestände an Staats- und Unternehmensanleihen. Allein die Staatsschulden liegen immer noch bei 105 Prozent des nominalen BIP – also bei 18,5 Billionen Dollar. Wenn die durchschnittlichen Renditen etwa von zwei auf vier Prozent anziehen sollten, bedeutet das einen Abschreibungsbedarf von rund zehn Prozent auf diesen Betrag und ist nicht leicht wegzustecken, wenn es innerhalb kurzer Zeit passiert. Eine Aufwertung stärkt im Übrigen die unter Wohlstandsgesichtspunkten erfreuliche Position des Dollar als Reservewährung.
Mit anderen Worten, sowohl die Amerikaner als auch die Europäer, Japaner und Chinesen freuen sich über das, was sich seit einiger Zeit an den Devisenmärkten tut. Kurzfristig ist eine weitere Aufwertung des Dollar daher wahrscheinlich.
Nur, es gibt auch Verlierer. Wer außerhalb Amerikas Dollarschulden hat, dürfte jetzt finanziell zunehmend ins Schleudern kommen. In Russland verschärft sich die Situation zusätzlich dadurch, dass der Ölpreis seit dem Sommer im weiter sinkt und die Erlöse aus Energieexporten – bisher 67 Prozent der gesamten Exporte oder 16,8 Prozent des BIP – damit wegbrechen. Eine Rezession scheint unvermeidlich.
Wieder einmal zeigt sich, dass niedrig verzinsliche Fremdwährungsschulden mit das Gefährlichste sind, was der Weltwirtschaft zustoßen kann. Per Saldo lassen sie sich ja nicht kurssichern – oder: Wenn man es täte, wäre der Zinsvorteil weg. Was die Sache zusätzlich so brisant macht, sind die gewaltigen Investitionen, die in den vergangenen Jahren in die Exploration und Förderung von Erdöl und Erdgas gesteckt worden waren, unter der Annahme, dass der Ölpreis nicht unter 100 Dollar fallen würde. Im vergangenen Jahrzehnt handelte es sich um jährlich knapp eine Billionen Dollar, kumuliert etwa acht Billionen Dollar. Sie sind, wie sich jetzt herausstellt, großenteils im wahrsten Sinne des Wortes in den Sand gesetzt worden und müssen abgeschrieben werden. Nicht nur die Unternehmen in den Schwellenländern befinden sich also in einer äußerst prekären Situation, sondern auch alle diejenigen, die bedeutende fossile Reserven auf der Aktivseite ihrer Bilanzen haben.
Eins ist bei alldem sicher: Es wird keine neue Inflationsspirale geben. Vielmehr wird das Deflationsrisiko in den Ländern der OECD mit Ausnahme der USA eher noch zunehmen.