Das Statistische Bundesamt hat am Donnerstag die erste Schätzung des Bruttoinlandsprodukts und seiner Komponenten für 2015 bekannt gegeben. Sowohl die Dynamik als auch die Struktur des Aufschwungs sind höchst erfreulich. Das reale BIP ist gegenüber 2014 um 1,7 Prozent gestiegen, die Inlandsnachfrage hat endlich die Exporte als Wachstumstreiber abgelöst, die Investitionen, das verfügbare Einkommen und die Beschäftigung haben allesamt kräftig zugelegt.
Einziger Schwachpunkt ist die langsame Zunahme der Produktivität – aber das ist schon seit Jahren so. In einer alternden Gesellschaft, die ohne eine jährliche Nettozuwanderung von 500.000 bis 800.000 Menschen auskommen möchte, lassen sich die Lasten für die Erwerbstätigen nur in Grenzen halten, wenn der Output pro Stunde deutlich rascher steigt als mit den Raten von nur etwa einem halben Prozent, bei denen sich der jährliche Produktivitätsanstieg inzwischen eingependelt hat. Es wird immer noch zu wenig investiert.
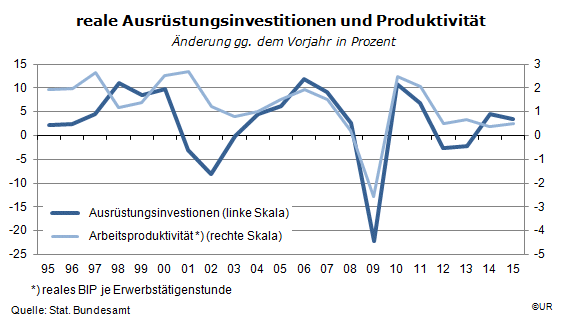
So gut die Zahlen auch sind, sie sind nur Durchschnittswerte und sagen daher wenig darüber aus, wie es um die wirtschaftliche Situation des Einzelnen steht. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive hat sich die Einkommensverteilung zum ersten Mal seit drei Jahren leicht zulasten der Arbeitnehmer entwickelt, aber real, nach Abzug der Inflationsrate, sind die Arbeitseinkommen 2015 erneut um rund drei Prozent gestiegen. Insgesamt hat die Diskussion über eine ungleiche Verteilung der Einkommen in letzter Zeit an Schärfe verloren, weil die Arbeitnehmer überproportional am Aufschwung partizipieren, wenn auch mit Maßen.
„Uns geht’s gut“ – das ist vor allem im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern eine treffende Aussage. Im vergangenen Jahr war das deutsche BIP real um sechs Prozent größer als 2008, dem Jahr vor der tiefen Rezession von 2009. Frankreich hatte in den sieben Jahren nur um rund drei Prozent zugelegt, während Italien und Spanien, die beiden anderen großen Länder des Euroraums, noch um sieben und vier Prozent unter ihren damaligen Höchstwerten lagen. Italien ist der neue kranke Mann Eurolands. Dagegen expandiert Spaniens reales BIP mittlerweile mit Raten von über drei Prozent; angesichts einer Arbeitslosenquote von über 20 Prozent und einer Jugendarbeitslosigkeit von 47,5 Prozent ist es wichtig, dass es bei diesen vergleichsweise hohen Zuwachsraten bleibt. Da Spanien im europäischen Kontext immer noch ein armes Land ist, besteht beträchtlicher Aufholbedarf; die Grenzerträge von Investitionen sind entsprechend hoch. Zusammen mit dem niedrigen Lohnniveau ergibt das ein attraktives Umfeld für Investitionen, einschließlich Direktinvestitionen aus dem Ausland.
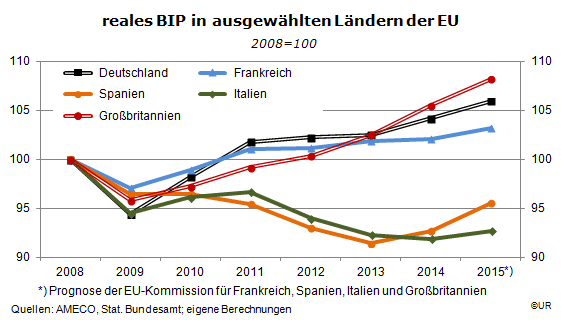
Es ist fast sensationell, wie gut es am deutschen Arbeitsmarkt läuft. Durch die langjährige Lohnzurückhaltung hat sich die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stark verbessert. Das gilt sowohl gegenüber den europäischen Nachbarländern als auch gegenüber dem Rest der OECD. Der gesunkene relative Preis der Arbeit hat zu einem kräftigen Anstieg der Beschäftigtenzahlen geführt – plus 5,7 Prozent seit 2008, obwohl es zwischendurch die tiefste Rezession der Nachkriegszeit gegeben hatte. Nach der Definition des Internationalen Arbeitsamts ILO ist die Arbeitslosenquote inzwischen auf unter fünf Prozent gefallen. Besonders erfreulich ist, dass die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten geradezu explodiert; im Oktober waren es beispielsweise 2,3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Wir nähern uns mit großen Schritten der Vollbeschäftigung.
Es überrascht daher nicht, dass jetzt auch die Löhne wieder kräftiger steigen. Sie waren in der Industrie zuletzt je Arbeitsstunde um 2,5 Prozent höher als vor Jahresfrist; die tariflichen Stundenlöhne steigen gesamtwirtschaftlich mit derselben Rate. Zusammen mit der guten Beschäftigung führte das zu einem Anstieg der sogenannten Masseneinkommen von rund vier Prozent; da die Inflationsrate nahe bei null lag, waren es real kaum weniger. So etwas hatten die Verbraucher seit Jahren nicht mehr erlebt und sie reagierten, indem sie ihre Konsumausgaben real um 1,9 Prozent steigerten. Die Zuwachsrate war mehr als doppelt so hoch wie in den Vorjahren. Es half offenbar, dass sie nur noch wenig Angst um ihre Arbeitsplätze hatten und Angstsparen daher nicht mehr so angesagt war. Alle Ökonomen, vor allem ausländische, hatten die Haushalte seit Jahren gedrängt, endlich doch bitte mehr Geld auszugeben, waren aber bis vor Kurzem auf taube Ohren gestoßen. Der Knoten scheint inzwischen geplatzt zu sein.
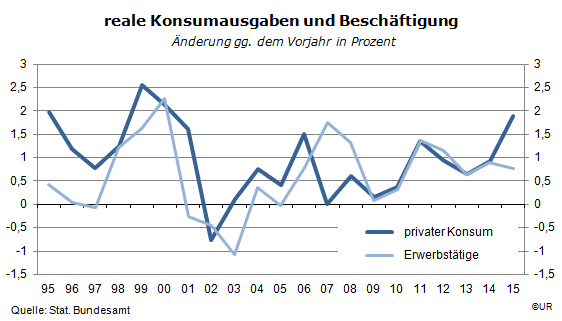
Eine Schwalbe macht natürlich noch keinen Frühling. In Deutschland wird immer noch viel mehr gespart als in anderen großen OECD-Ländern. Selbst der Staat und sogar der Unternehmenssektor haben sich trotz der rekordniedrigen Zinsen zu Nettosparern gemausert, so dass das Land 2015 insgesamt netto Kapital in Höhe von acht Prozent des BIP exportieren musste; in absoluten Zahlen waren das etwa 250 Milliarden Euro. Nur China kam auf einen ähnlichen Wert. Von daher gibt es einen großen Spielraum für einen lang anhaltenden Konsumboom. Dadurch ließen sich im Übrigen die deutschen Einfuhren nachhaltig steigern, was wiederum unseren europäischen Handelspartnern gut tun und die Fliehkräfte des Euro reduzieren würde. Zudem sinkt das Risiko einer Deflation, wenn die Konsumnachfrage in Schwung kommt. Bislang gibt es erfreulicherweise keine Anzeichen, dass die deutschen Verbraucher wieder einen Rückzug machen könnten – durch die rückläufigen Ölpreise bekommen ihre Realeinkommen gerade wieder einen neuen Schub. Wir arbeiten nicht, um zu sparen, sondern um zu konsumieren. Schön wär’s, wenn sich das auch über unsere Landsleute sagen ließe, ein bisschen jedenfalls.
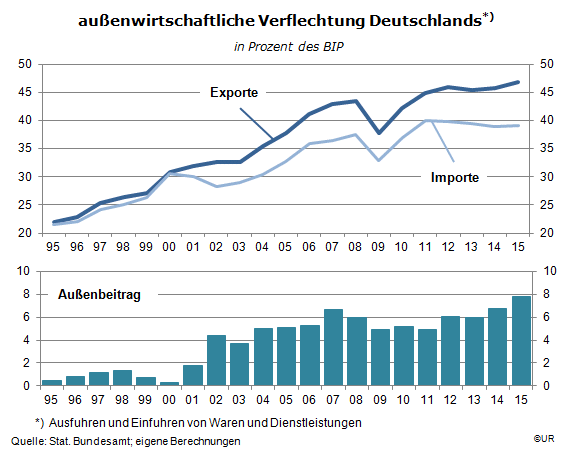
Es spricht viel dafür, dass Deutschland wegen der robusten Binnennachfrage, des Endes der fiskalpolitischen Restriktionen und der großen finanziellen Spielräume nicht in den Strudel der globalen Rezession gezogen wird, der sich jetzt abzeichnet. Es ist einigermaßen sicher, dass der Gegenwind im internationalen Handel stärker wird. Wir haben es zurzeit mit einer Art Abwertungswettlauf zu tun. Die Währungen Chinas sowie praktisch aller Rohstoffländer sind sehr schwach, so dass sich die deutschen Preise in ausländischer Währung stark erhöht haben. Andererseits wird unsere Wirtschaft real mehr importieren, weil die Konjunktur relativ gut läuft und die Einfuhrpreise sehr niedrig sind. Das bedeutet, dass der sogenannte Außenbeitrag wie zuletzt im Jahr 2013 schrumpfen, also Wachstum kosten könnte. 2016 wird kein leichtes Jahr.