Im Februar waren die harmonisierten Verbraucherpreise Eurolands niedriger als vor einem Jahr (-0,2 Prozent); schon 2015 war es einige Mal zu negativen Inflationsraten gekommen. Die EZB argumentiert ständig, dass das vor allem an den gesunkenen Preisen für Erdöl und andere Rohstoffe liege, nicht an fundamental deflationären Prozessen, dass die Kerninflation nämlich deutlich höher sei als Null. Leider ist das nur Wunschdenken. Im Februar war sie im Vorjahresvergleich auf 0,7 Prozent gesunken, nach 1,0 Prozent im Januar und Raten um die ein Prozent in den neun Monaten zuvor. Sie will und will nicht auf ein beruhigendes Niveau in der Nähe von zwei Prozent steigen. Da die Preise auf den vorgelagerten Stufen fallen, also bei den Einfuhren, im Großhandel und bei industriellen Produkten, ist vielmehr damit zu rechnen, dass sich der scharfe Rückgang der Inflationsraten bei den Verbrauchern, der seit Anfang 2012 zu beobachten ist, fortsetzen wird. Die Deflation scheint sich einzunisten.
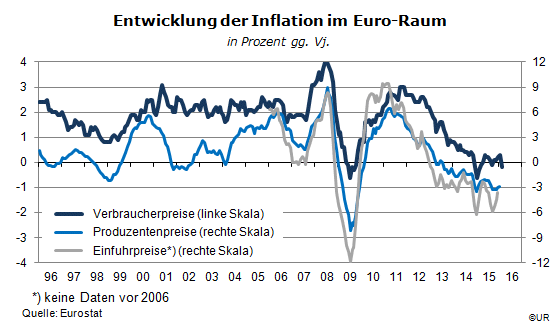
Mario Draghi sieht seine Felle davonschwimmen und wird daher am 10. März eine neue Runde expansiver Maßnahmen verkünden. Er hat zwar bei der letzten Pressekonferenz versichert, dass alle denkbaren Instrumente geprüft würden, realistischerweise wird es aber nur darum gehen, die Zinsen auf die Einlagefazilität weiter zu senken – von -0,3 Prozent auf vielleicht -0,5 Prozent – und/oder das Ankaufsprogramm noch einmal aufzustocken und zu verlängern, also einfach draufzusatteln. Die Medizin hat bisher nicht gewirkt, erhöhen wir also die Dosis.
Ein erwünschter Effekt hat sich allerdings bereits eingestellt: Der Euro hat in Erwartung eines größeren Angebots auf den Devisenmärkten in den letzten drei Wochen kräftig abgewertet. Tendenziell wird dadurch zum Einen weniger Deflation importiert, zum Anderen verbessert sich die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Produkte; das hilft der Konjunktur. Es ist nur zu wünschen, dass das nicht von der internationalen Konkurrenz als Auftakt für einen Währungskrieg angesehen wird. Japan, China, die Schweiz und Großbritannien dürften kaum stillhalten.
Ein anderer, ebenfalls erwünschter Effekt ist die Stabilisierung der europäischen Aktienmärkte: In den ersten beiden Wochen des Jahres sah es nach einem Crash aus. Inzwischen haben sich die Kurse im Durchschnitt wieder um knapp 10 Prozent erholt. Die Marktteilnehmer sind sich sicher, dass die EZB sie nicht hängen lassen wird. An Liquidität wird es nicht mangeln, und der scheinbar unaufhaltsame Rückgang der Bondrenditen durch die Käufe der EZB hat ein Übriges dafür getan, dass Aktien zumindest relativ wieder attraktiver wurden. Zehnjährige Bundesanleihen rentieren nur noch mit 0,2 Prozent; auch an den übrigen europäischen Bondmärkten bewegen sich die Renditen in der Nähe ihrer Rekordtiefs.
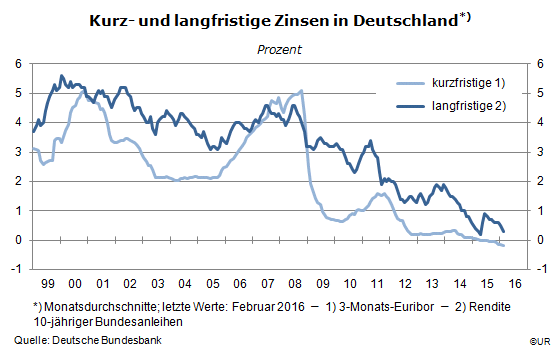
Wenn die niedrigen Zinsen und die günstigen Kreditkonditionen schon nicht dazu führen, dass die Kreditvergabe zunimmt, könnte die Konjunktur wenigstens mit Hilfe des sogenannten Vermögenseffekts anspringen – die Leute fühlen sich durch die Kursgewinne reicher, müssen nicht so viel sparen und geben mehr Geld aus. Bingo! Nur dass der Wertpapierbesitz nicht so verbreitet ist, oder nicht so wichtig für das Ausgabenverhalten der Haushalte. Auch die börsennotierten Unternehmen reagieren nicht unbedingt auf euphorische Art auf den Anstieg ihres Marktwerts, sprich, sie steigern nicht Eins zu Eins ihre Investitionsausgaben. Sie kaufen mit ihren teureren eigenen Aktien oft lieber andere Unternehmen, was gesamtwirtschaftlich nicht viel bringt – die Manager erhalten immerhin Boni, steigern also ihr Einkommen und sind in der Lage, mehr zu konsumieren. Nur haben sie meist eine hohe Sparquote. Außerdem verändert eine Politik zugunsten der Besitzer von Wertpapieren die Vermögensverteilung zulasten der ärmeren Schichten. Insgesamt kann sich die EZB nicht auf Vermögenseffekte verlassen, wenn sie die Konjunktur stimulieren und die Inflationsraten erhöhen möchte.
Sehr niedrige Zinsen können zudem kontraproduktiv wirken. Darauf hatte kürzlich Daniel Gros vom Brüsseler Center for European Policy Studies hingewiesen: „Unter bestimmten Umständen können niedrigere Zinsen zu höheren Ersparnissen führen. Da sie das Einkommen der Sparer mindern, verbrauchen diese weniger, insbesondere wenn sie ein Sparziel für ihre Altersvorsorge verfolgen.“ Studenten der Volkswirtschaft dürften sich an das Konzept der rückwärts gekrümmten Sparkurve erinnern. Eine öffentliche Diskussion über dieses Konzept wurde vor Jahren in Japan geführt, weil sich auch dort die Zinspolitik als stumpfes Schwert erwiesen hatte – und heute noch ist.
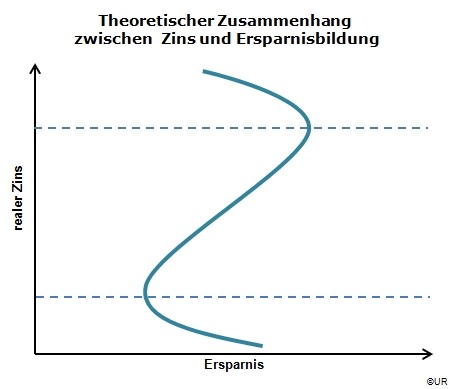
Gros macht zudem darauf aufmerksam, dass niedrige Zinsen Schuldnern nützen, Gläubigern aber schaden. Euroland insgesamt ist gegenüber dem Rest der Welt wegen der gewaltigen deutschen und holländischen Leistungsbilanzüberschüsse seit einigen Jahren in einer Gläubigerposition, so dass es durch die sinkenden Zinsen mehr Verlierer als Gewinner gibt. Das steht im krassen Gegensatz zur Situation in den USA und Großbritannien mit ihren strukturellen Leistungsbilanzdefiziten: Die expansive Politik der Zentralbanken schlägt dort viel besser an als hierzulande, abzulesen am robusten Wachstum ihrer Volkswirtschaften.
Im Übrigen verlangsamt die Minuszinspolitik der EZB die Sanierung des Bankensektors – auch das ist ein nicht-gewollter Nebeneffekt. Durch das Bond-Ankaufsprogramm haben die Banken seit Ende 2014 gewaltige Überschussreserven bei der EZB angehäuft, auf die sie zurzeit einen Strafzins von 0,3 Prozent zu zahlen haben. Per Ende Februar waren es 672 Mrd Euro. Sollte der Strafzins tatsächlich am 10. März auf 0,5 Prozent angehoben werden, würden Banken auf’s Jahr gerechnet 3,36 Mrd Euro verlieren, Tendenz steigend, weil das Ankaufsprogramm weiterläuft und das Kreditgeschäft, mit dem die Überschussreserven zumindest verringert werden könnten, einfach nicht in die Gänge kommt.
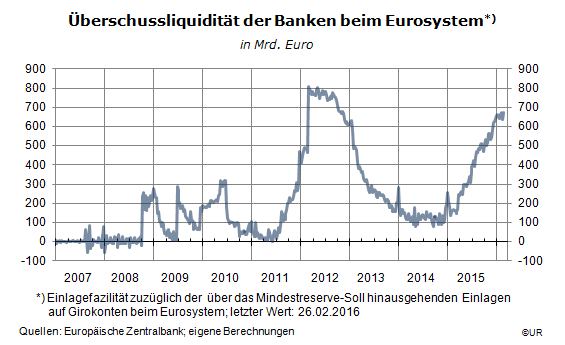
Zu guter Letzt leidet Euroland intern nach wie vor unter der Schuldenlast des privaten Sektors. Gegenüber der Zeit vor der Finanzkrise sind die Schulden in Relation zum nominalen BIP nicht geringer geworden und liegen auf Rekordniveau, so dass Schuldenabbau (deleveraging) weiterhin eine große Rolle spielt und verhindert, dass sich ein kreditfinanzierter Aufschwung entwickelt. Anders ausgedrückt, der private Sektor hat nicht die Kraft, die große gesamtwirtschaftliche Lücke zwischen aktuellem und potenziellem Output zu füllen.
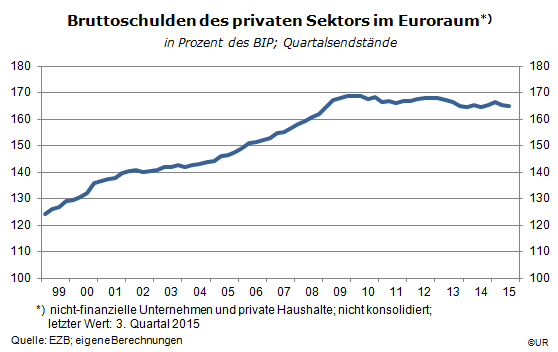
Es gibt nur einen Akteur, der da helfen kann: den Staat. Nicht nur in den Überschussländern, vor allem aber dort, ist er gefordert, Wachstumsprogramme aufzulegen. Die langfristigen Zinsen sind so niedrig wie noch nie und an bislang vernachlässigten Aufgaben herrscht wahrlich kein Mangel, man denke nur an die Infrastruktur, das Bildungswesen oder die Umwelt. Im Nachhinein wird der Fokus auf den Abbau staatlicher Defizite einmal als der größte Fehler der heutigen Wirtschaftspolitiker gelten: Statt dieses kurzfristige und letztlich irrelevante Ziel zu verfolgen, hätte alles dafür getan werden müssen, dass Produktivität und mit ihr das Potenzialwachstum endlich wieder stärker zunehmen. Wer immer nur spart, verhindert Wachstum und Wohlstand. Das ist bekannt unter dem Stichwort „Paradox des Sparens“.