Vergangenen Donnerstag hat Benoît Cœuré vom Vorstand der EZB an der Yale University einen Vortrag über negative Zinsen gehalten. Seine Botschaft: Obwohl die nominalen kurzfristigen Zinsen schon weit in den negativen Bereich vorgedrungen sind, könnten sie theoretisch noch ein ganzes Stück weiter sinken. Warum? Weil es bisher keine Anzeichen dafür gebe, dass die Leute von kurzfristigen Wertpapieren, auf die sie zurzeit gewissermaßen Strafzinsen zahlen, auf Bargeld umsteigen – Bargeld verzinst sich immerhin mit null Prozent. Ich habe diese Aussage anhand der EZB-Pressenotiz vom 27. Juli überprüft. Sie stimmt. Das Volumen der Bankeinlagen und Geldmarktpapiere expandiert nach wie vor stärker als der Bargeldumlauf. Von einer Flucht in Bares ist also noch nichts zu erkennen.
Banken haben im Übrigen auch noch nicht damit begonnen, Kleinanlegern negative Zinsen auf ihre Einlagen zu berechnen, obwohl sie ihrerseits Geld verlieren, wenn sie ihre Überschussreserven bei der EZB deponieren. Sie haben Angst vor einem Volksaufstand, scheint es.
Dennoch rät Cœuré davon ab, den Spielraum bei den Leitzinsen tatsächlich zu nutzen. Wir seien in der Nähe des Punktes, an dem die erwünschten Effekte negativer Zinsen auf Konjunktur und Inflation durch die unerwünschten Effekte auf den Bankensektor aufgewogen werden – weitere Senkungen könnten aus der expansiven eine restriktive Geldpolitik machen, wären also kontraproduktiv. Implizit sagt er daher auch, dass an der Zinsfront erst einmal Ruhe herrschen wird. Die Zinspolitik ist ausgereizt.
Bisher haben die negativen Einlagezinsen der EZB laut Cœuré per Saldo positiv gewirkt. Zusammen mit dem massiven Ankaufprogramm für Wertpapiere und der Ankündigung der EZB, dass die Zinsen auf lange Zeit sehr niedrig bleiben werden (forward guidance), haben sie verhindert, dass sich Wachstum und Inflation weiter abschwächten und die realen Zinsen anstiegen, was eine Rückkehr zu Vollbeschäftigung noch mehr erschwert hätte.
Die Menschen regten sich zu Unrecht über die niedrigen nominalen Zinsen auf. Zwar sinken die Zinseinnahmen, aber gleichzeitig müssen weniger Schuldzinsen bezahlt werden – das Nettozinseinkommen der europäischen Haushalte habe sich kaum verändert. Es sei allerdings zu einer Umverteilung gekommen, von den Nettosparern zu den Nettoschuldnern. Da Letztere meist eine höhere Ausgabeneigung haben, hat das den Konsum und die Konjunktur stimuliert.
Cœuré konzediert, dass negative Nominalzinsen auf die Stimmung schlagen können. Weil sie es Sparern und Schuldnern erschweren, sich bei ihren täglichen Entscheidungen zu orientieren. Viele Menschen unterliegen darüber hinaus der sogenannten Geldillusion und bewerten ihr Vermögen, ihr Einkommen und ihre Käufe danach, wie sich ihr Wert nominal entwickelt. Wenn er fällt oder nur sehr langsam zunimmt, kann er in einem deflationären Umfeld dennoch real steigen. Nicht alle verstehen das.
Cœuré weist darauf hin, dass die realen Sparzinsen in der Bundesrepublik sehr häufig negativ waren, ohne dass es deswegen in der Öffentlichkeit zu Protesten gekommen sei. Nominal waren sie ja auch stets nicht nur im positiven Bereich, sondern deutlich über der Nulllinie.
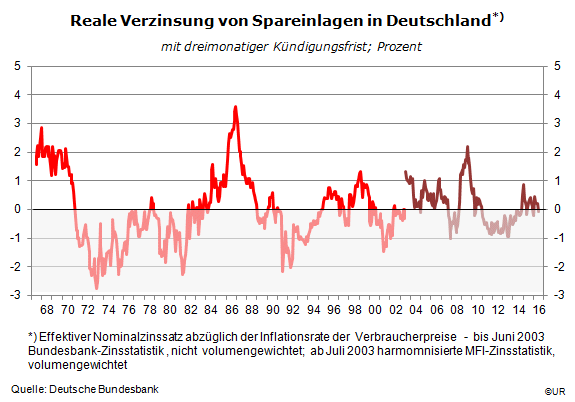
Was nun die Banken angeht, ist es nicht nur vorstellbar, sondern sogar eine akute Gefahr, dass von einem bestimmten Punkt an die niedrigen Zinsen mehr schaden als nutzen. Sie nutzen anfangs, weil die Anleihebestände in dem Maße an Wert gewinnen, wie das Zinsniveau sinkt; das steigert die Gewinne. Auf kurze Sicht nehmen auch die Zinsmargen zu: Die (kurzfristige) Refinanzierung wird unmittelbar günstiger, die Zinsen auf (längerfristige) Aktiva werden dagegen in der Regel erst verzögert angepasst. Ein positiver Effekt ist zudem, dass das Volumen der notleidenden Kredite zurückgeht: Sinkende Zinsen reduzieren den Schuldendienst, sodass Rückstellungen aufgelöst werden können und so den Gewinn erhöhen. Wird durch die Zinspolitik die Konjunktur stimuliert, verbessert sich die geschäftliche Lage im Allgemeinen, und die der Banken im Besonderen.
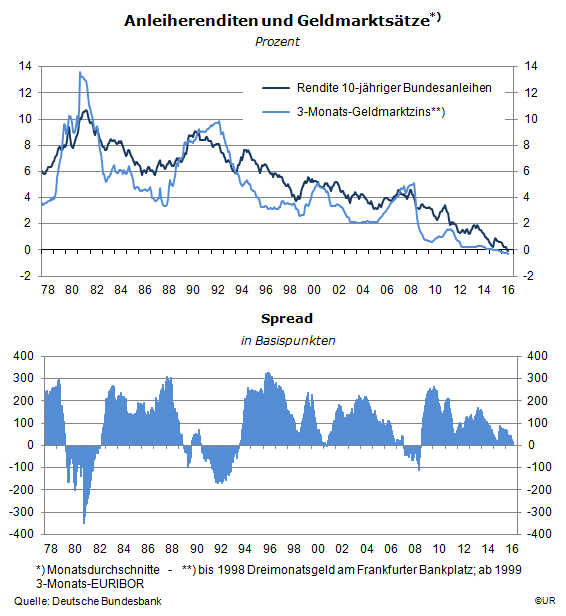
Auf Dauer vermindern niedrige Zinsen jedoch den Netto-Zinsertrag der Banken. Wie erwähnt, wagen sie nicht, auf die Einlagen von Haushalten negative Zinsen zu berechnen, selbst wenn die EZB das mit ihren eigenen Einlagen macht (zurzeit -0,4 Prozent). Wir reden hier im Euroraum über einen Betrag von fast sechs Billionen Euro oder 62 Prozent aller Einlagen von Nicht-Banken. Wenn die Zinsen ständig sinken, vermindern sich die Erträge der Aktiva, während sich auf der Zinskostenseite nichts tut. Die Zinsmarge schrumpft.
In der aktuellen Situation Eurolands verflacht sich die Zinsstrukturkurve auch deshalb, weil die Anleger erwarten, dass die kurzfristigen Zinsen für lange Zeit niedrig bleiben werden. Die EZB bestärkt sie mit ihrer forward guidance ausdrücklich darin. Es ist für die Sparer eine relativ risikolose Strategie, die Laufzeit ihrer Portefeuilles zu verlängern. Durch die Umschichtung von kürzeren in längere Fristen kommen die Renditen am langen Ende runter. Diese Tendenz wird durch das Ankaufsprogramm der EZB beträchtlich verstärkt – monatlich nimmt sie netto rund 80 Milliarden Euro an länger laufenden Papieren aus dem Markt, erhöht dadurch deren Preise und senkt auf diese Weise ebenfalls die Renditen. Je flacher die Zinskurve, desto weniger können Banken durch die sogenannte Fristentransformation verdienen, sie verlieren ihre wichtigste Einnahmequelle.
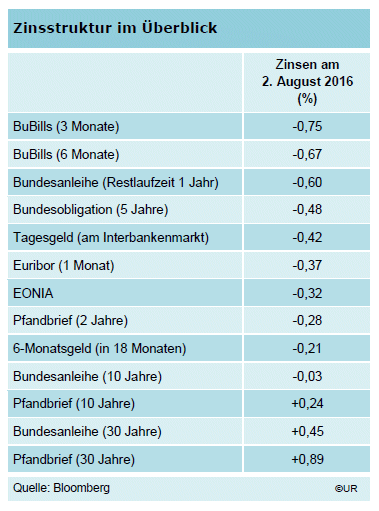
Was tun? Cœuré argumentiert, dass sie im Wesentlichen auf zweierlei Art reagieren. Zum einen werden sie höhere Risiken eingehen, weil die mit höheren Erträgen verbunden sind. Das sei empirisch nachgewiesen. Sie legen beispielsweise weniger strenge Maßstäbe an ihre Kreditvergabe an oder erwerben Aktiva, die weniger liquide sind. Das sei zwar gut für die gesamtwirtschaftliche Investitionstätigkeit, mache die Banken aber anfälliger. Zudem nimmt der Anreiz zu, auf eigene oder auf Rechnung ihrer Kunden zu spekulieren, also ihren Informationsvorsprung profitabel zu nutzen. Da Geld billig zu haben ist, kann die Wirkung mit geliehenen Mitteln noch einmal gesteigert werden. Flache Zinskurven und niedrige Zinsen fördern die Bildung von Aktien- und Immobilienblasen und unterminieren so die Finanzstabilität.
Die andere Antwort der Banken auf den Einbruch ihres vormals wichtigsten Geschäftszweigs besteht darin, die Kosten zu senken, also zu fusionieren, Geschäftsfelder abzustoßen, Filialen zu schließen, immer mehr Dienstleistungen zu automatisieren und auf die Kunden zu verlagern, vor allem aber Personal einzusparen. Dieser Prozess kann überall in Europa besichtigt werden. Ein Umstieg auf Aktivitäten, mit denen sich Beratungsgebühren verdienen lassen, dürfte für die wenigsten Banken eine realistische Alternative sein. Der Sektor schrumpft.
Insgesamt haben die Banken noch keinen festen Boden unter den Füßen. Nur wenige sind so profitabel, dass sie ihre Eigenkapitalbasis aus zurückbehaltenen Gewinnen dotieren können. Inzwischen sind ihre Aktien zu Ausverkaufspreisen zu haben. Der jüngste Stresstest der European Banking Authority (EBA) hat gezeigt, dass viele europäische Banken ins Schleudern geraten würden, wenn sich die Rahmenbedingungen noch einmal in ähnlicher Weise verschlechtern sollten wie in den Jahren vor dem Ausbruch der Finanzkrise. Deutsche Bank und Commerzbank hätten dann mit die schlechtesten Bilanzrelationen.
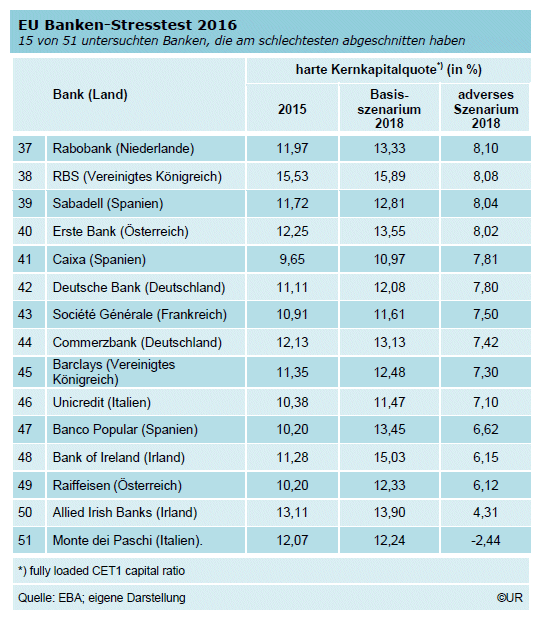
Für Cœuré wird die Lage allmählich kritisch, ohne dass er das so klar sagt. Offiziell setzt er darauf, dass „die anhaltende wirtschaftliche Erholung die Einkommenssituation von Haushalten und nicht-finanziellen Unternehmen der Eurozone verbessern wird, wodurch wiederum die Risiken, die mit dem Schuldenüberhang in einigen Ländern verbunden sind, abgemildert werden dürften.“ Auch sieht er, dass sich der Immobilienmarkt weiter erholt.
Im Übrigen plädiert er dafür, dass das Projekt der europäischen Kapitalmarktunion endlich ernsthaft angegangen wird – dadurch würde ein Teil der Risiken von den stets krisenanfälligen Banken auf die Käufer der Finanzprodukte verlagert und das System insgesamt stabiler. Das ist natürlich eine gute Sache, aber in der jetzigen Situation eher Wunschdenken, und kurzfristig ohnehin keine Hilfe.
Nur ganz versteckt am Ende, und ohne weitere Erklärung, gibt er indirekt zu, dass die Geldpolitik nicht mehr viel bewirken kann. Andere Akteure müssen her: „Finanzpolitische und strukturpolitische Maßnahmen sollten entschlossener zur Stimulierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der Produktivität eingesetzt werden und auf diese Weise verhindern, dass die Wirtschaft doch noch in das Niedrigzinsloch fällt.“
Sag‘ ich doch!