Wenn es im Herbst des kommenden Jahres immer noch keine Anzeichen dafür geben sollte, dass sich die Inflationsrate Eurolands in absehbarer Zeit ihrem Zielwert von knapp unter zwei Prozent nähert, spricht aus Sicht der EZB nichts dagegen, die Anleihekäufe über den Dezember 2017 hinaus fortzuführen und notfalls sogar aufzustocken – so Mario Draghi auf der Pressekonferenz am vergangenen Donnerstag. Keine Rede davon, dass die Inflation schon bald anziehen wird. Ganz im Gegenteil, die EZB ist äußerst skeptisch und rechnet daher nicht damit, dass sie schon 2017 gezwungen sein könnte, das Ankaufsprogramm einzustellen.
Ich halte das für Zweckpessimismus. Es sieht danach aus, dass sowohl das Wachstum als auch die Inflationsraten schon bald höher ausfallen werden als allgemein erwartet.
Vielleicht will die EZB, dass der Euro weiter abwertet und die Zinsen niedrig bleiben, es also nicht zu einer restriktiveren Geldpolitik kommt. Vor allem im Süden der Währungsunion ist die Wirtschaft nämlich noch lange nicht über den Berg: Die Arbeitslosigkeit ist dort nach wie vor gefährlich hoch, insbesondere die der Jugendlichen; der Euro gilt zunehmend als Wachstumsbremse und wird von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt. Eine expansive Geldpolitik erleichtert den staatlichen Schuldendienst und verschafft Spielraum für die nötigen Reformen.
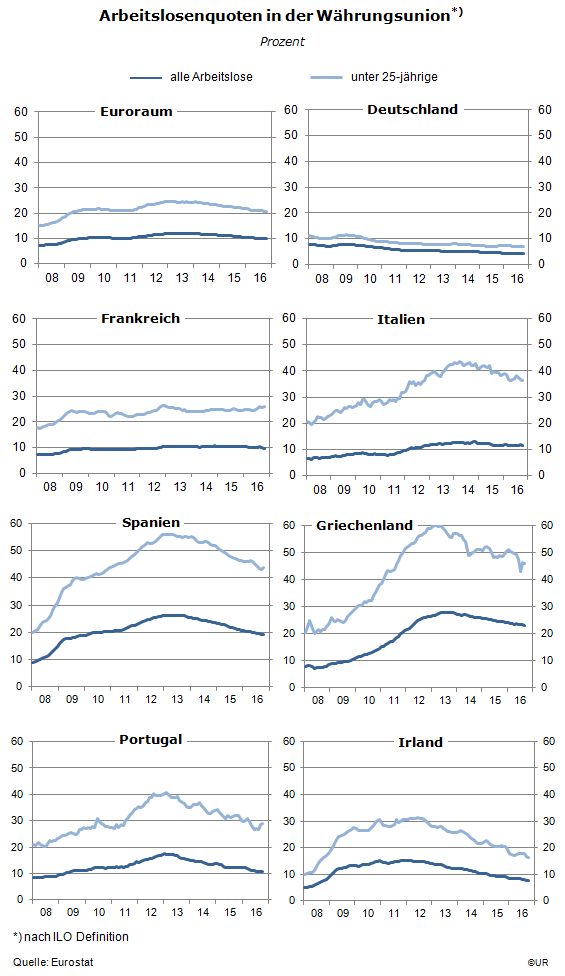
Dennoch könnte die EZB rascher gezwungen sein, einen Kurswechsel einzuleiten als sie das im Augenblick glauben mag. Es spricht Einiges dafür, dass sich die Konjunktur weiter verbessert und die Inflation demnächst Fahrt aufnimmt. Sowohl die Analysten als auch die Notenbanken sind nicht dafür bekannt, ökonomische Wendepunkte verlässlich vorherzusagen. Ich denke, dass sie mit ihrer Prognose einer rückläufigen Wachstumsrate im Jahr 2017 und anhaltend niedriger Inflation auch diesmal danebenliegen werden.
Am wichtigsten sind die Effekte, die vom Ausland auf das Preisniveau und die Beschäftigung Eurolands ausgehen. Anders als die USA, China und selbst das relativ kleine Japan ist die Währungsunion sehr stark in die Weltwirtschaft eingebunden. Wie die folgende Grafik zeigt, ist der Anteil der Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen am nominalen BIP im Trend stark gestiegen und beträgt inzwischen fast 50 Prozent – das ist fast doppelt so viel wie in den USA. Das wiederum bedeutet, dass die Abhängigkeit Eurolands vom Wechselkurs und der Konjunktur in Drittländern ungewöhnlich stark ist. Auch wenn Herr Trump das anders sehen mag, die amerikanische Wirtschaft wird vor allem von inländischen Faktoren getrieben, weniger vom Handel mit Mexiko und China. Euroland, mit seiner ähnlich großen Bevölkerung, ist deutlich stärker international exponiert.
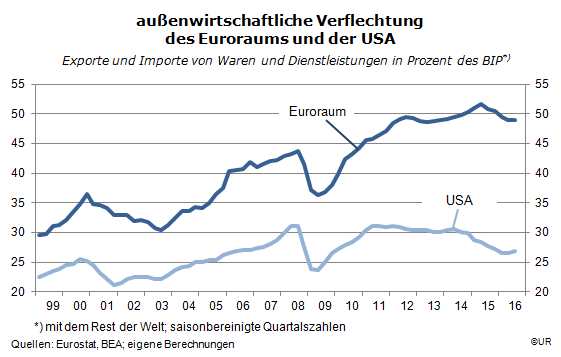
Seit Beginn des Jahres nehmen die Einfuhrpreise Eurolands insbesondere aus zwei Gründen kräftig zu: wegen des Anstiegs des Ölpreises und anderer Rohstoffpreise sowie der Schwäche des Euro. Für die vergangenen sechs Monate sind sie mit einer annualisierten Rate fast sechs Prozent gestiegen. Ähnliches gilt für die industriellen Erzeugerpreise, die ebenfalls stark vom Ausland abhängen – auch hier gab es eine Zuwachsrate von knapp sechs Prozent. Mit anderen Worten, es steckt neuerdings eine Menge Inflation in der europäischen Pipeline. Die Frühindikatoren deuten daher darauf hin, dass die Verbraucherpreise demnächst kräftiger ansteigen werden. Da sich bisher bei ihnen kaum etwas getan hat, erwarten die meisten Analysten, dass das so bleiben wird. Ginge es nach den Käufern inflationsgeschützter Bundesanleihen, wird die Inflation in den nächsten zehn Jahren im Durchschnitt nur bei eineinviertel Prozent liegen. Sie irren sich.
Unterdessen schlagen sich die starke Expansion des Zentralbankgeldes sowie Leitzinsen in der Nähe von Null in der Kreditvergabe an den privaten Sektor Eurolands nieder. Im Vorjahresvergleich ist die Zuwachsrate der Kredite von Anfang 2014 bis vergangenen Oktober stetig von -2,3 auf plus 2,3 Prozent angestiegen, wobei das meiste davon auf Immobilienkredite und längerfristige Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen entfällt, wurde also nicht, wie man vermuten könnte, für spekulative Zwecke am Aktienmarkt verwendet. Die ständigen neuen Kursrekorde an den Aktienmärkten sind zumindest bis heute nicht kreditgetrieben und daher nicht gefährlich: Bei einem Kurseinbruch käme es kaum zu Überschuldungsproblemen.
Da die EZB ihre Politik für’s Erste nicht ändern wird, also weiter massiv Liquidität in den Bankensektor pumpt, rechne ich damit, dass die Kredite schon bald rascher zunehmen werden als das nominale BIP Eurolands, mit der Folge, dass sich Preiserhöhungen leichter durchsetzen lassen – und mehr investiert wird.
Seit 2015 ist für die Europäische Kommission die Phase extrem restriktiver Finanzpolitik in den 19 Euroländern beendet. Seit diesem Jahr wird die Konjunktur erstmals wieder durch Steuersenkungen und eine raschere Zunahme der Ausgaben stimuliert, wenn auch nur sehr moderat. (vgl. European Commission: Quarterly Report on the Euro Area. Vol. 15, No. 3, December 2016). Immerhin. Ich gehe davon aus, dass die bisherigen Konsolidierungserfolge zusammen mit dem Druck durch die anstehenden Wahlen in Italien, den Niederlanden, Frankreich und nicht zuletzt in Deutschland zu einer expansiveren Ausrichtung der Finanzpolitik führen werden als bislang angenommen. Am größten ist der Handlungsspielraum in Deutschland – nur wird er de facto nicht genutzt. Wolfgang Schäuble hat es mit seiner schwarzen Null zum populärsten Politiker des Landes geschafft und sieht nicht ein, warum er mehr als kosmetische Konzessionen machen sollte.
Insgesamt stehen die Ampeln also auf Grün: expansive Geldpolitik, expansive Finanzpolitik, eine schwache Währung, robustes Wirtschaftswachstum im Rest der Welt. Die drei größten globalen Risiken – ein Crash in China, eine neue Eurokrise, ein Handelskrieg – scheinen aus heutiger Sicht abwendbar beziehungsweise nicht systemgefährdend zu sein. Hinzu kommt, dass die Beschäftigung im Euroraum seit zwei Jahren zügig zunimmt und die Umfragewerte – Ifo, die PMIs und das Verbrauchervertrauen – nach oben weisen und ein hohes Niveau erreicht haben. In Deutschland sind die Auftragseingänge in der Industrie und im Bau zuletzt geradezu explodiert.
Vielleicht tut es der Konjunktur zudem gut, dass jetzt die langen Zinsen zu steigen begonnen haben. Wer erwartet, dass er demnächst für seine Investitionen höhere Zinsen berappen muss, wird seinen Kreditantrag und damit seine Ausgaben vorziehen. So günstig wie jetzt wird man nicht mehr lange an sein Geld kommen. Im Übrigen drohen Kursverluste bei den festverzinslichen Wertpapieren, so dass diese Form der Ersparnis gemieden werden sollte. Wir leben in einer Zeit, in der man tendenziell nicht sparen sondern Schulden machen sollte.
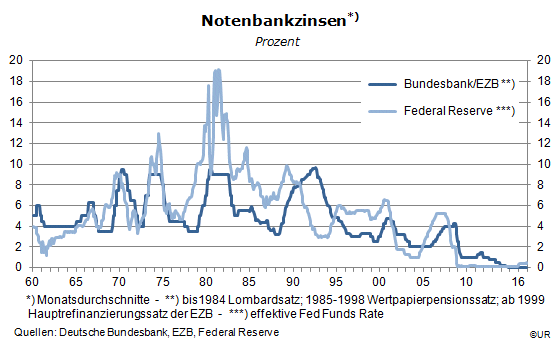
Last but not least: Die Verlautbarungen zum letzten FOMC-Meeting, dem geldpolitischen Entscheidungsgremium der Federal Reserve, legen nahe, dass die US-Notenbank die Leitzinsen 2017 noch dreimal erhöhen wird. Im vierten Quartal 2017 dürfte die Fed Funds Rate daher bei rund 1,3 Prozent liegen. Wenn die EZB nicht irgendwann nachzieht, droht ein freier Fall des Euro, verbunden mit Aufforderungen der Trump-Regierung, etwas dagegen zu unternehmen – sonst sei sie gezwungen, Euroland zum „Währungsmanipulator“ zu erklären und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Japan und China wissen ein Lied davon zu singen. Nur zur Erinnerung: Wie die obige Grafik zeigt, sind Bundesbank und EZB in der Vergangenheit einem Kurswechsel der Fed im Durchschnitt mit einer Verzögerung von etwa einem Jahr gefolgt. Seit der ersten Zinserhöhung ist bereits ein Jahr vergangen. Diesmal kann es länger dauern als sonst, aber auf Dauer wird sich die EZB nicht abkoppeln können.
Ich würde also nicht so viel darauf geben, dass Draghi vorhat, soweit das Auge reicht bei seiner expansiven Mengenpolitik zu bleiben. Er wird es nicht können, und wird es auch nicht müssen.