Immer wieder wird behauptet, dass die Fähigkeit eines Landes, seine Währung bei Bedarf abzuwerten, unabdingbar sei für robustes Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung. Ich bezweifle das. Sicher, in der kurzen Frist hilft es, wenn man seine Preise senkt – eine Abwertung ist nichts anderes –, auf Dauer aber fördert kaum etwas den Wohlstand so sehr wie ein tendenziell steigender Wechselkurs, genauer: ein moderat steigender Wechselkurs. Zu viel des Guten ist natürlich schädlich, aber noch schädlicher ist es, ständig seine Preise zu senken und den billigen Jakob zu spielen. Die bessere Strategie besteht darin, attraktive Produkte und Dienstleistungen anzubieten, die sich auch zu vergleichsweise hohen Preisen verkaufen lassen.
Im Blog Social Europe hat Claus Offe von der Hertie School of Governance in Berlin gerade argumentiert, der Euro sei vor allem im Interesse Deutschlands – weil sein Wechselkurs durch die zahlreichen Mitgliedsländer, denen es an Wettbewerbsfähigkeit fehle, tendenziell zur Schwäche neige. Hätten wir noch die D-Mark, wäre die angesichts der gesunden deutschen Fundamentals superfest und die Konjunktur wäre nicht so gut wie sie ist. Der schwache Euro habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Wirtschaft brummt.
Im Umkehrschluss bedeute das, dass viele der anderen Länder mit einem für sie zu starken Euro zurechtkommen müssen. Für sie ist er eine Last. Angesichts hoher Arbeitslosigkeit und negativer Leistungsbilanzsalden wäre eine Abwertung die richtige Medizin. Da das in einer Währungsunion nicht möglich ist, müssen sie auf andere Weise versuchen, international wettbewerbsfähiger zu werden. Es gibt nur eine Alternative: die sogenannte interne Abwertung. Darunter versteht man im Wesentlichen eine restriktive Finanzpolitik, kombiniert mit niedriger oder sogar rückläufiger Lohninflation. Sie seien gezwungen, die inländische Nachfrage so stark zu dämpfen, dass ihr Preisniveau langsamer zunimmt als bei ihren Handelspartnern. Rezession statt Abwertung und Wachstum!
Offe überschätzt die Vorteile einer abwertenden Währung. Sie ist wie eine Droge, an die sich ein Land gewöhnen kann. Wenn ich nicht mehr richtig wettbewerbsfähig bin, senke ich meine Preise. Das ist vergleichbar mit dem Angestellten, der seinen Job verliert und daraufhin seine Gehaltswünsche zurückschraubt. Das kann man einmal machen, aber langfristig ist das keine gute Strategie. Es geht auch anders.
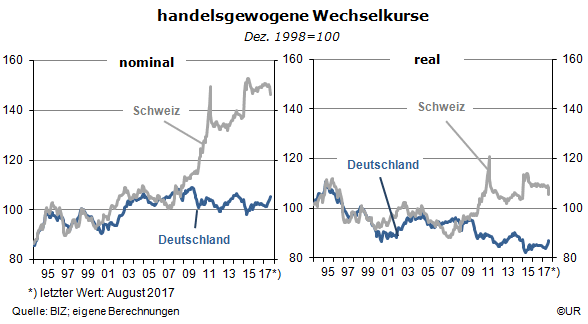
Das Musterbeispiel ist die Schweiz. Wie die beiden Schaubilder zeigen, lebt die Schweiz seit Jahrzehnten nicht nur mit einer starken nominalen Aufwertung ihres handelsgewogenen Wechselkurses, auch real, also unter Berücksichtigung der Inflationsdifferenzen gegenüber dem Ausland, steigt der Franken seit vielen Jahren kräftig an. Mit anderen Worten, das Land verliert ständig an internationaler Wettbewerbsfähigkeit. Allerdings nur von den Preisen her! Preise sind aber nicht Alles. Die Schweizer Wirtschaft wehrt sich, indem sie auf Forschung und Entwicklung setzt, die Mitarbeiter ständig weiterbildet und ihren Kapitalstock durch eine hohe Investitionsquote vergrößert und modernisiert. Flankiert wird das durch staatliche Ausgaben für Infrastruktur, Bildung und Soziales, die weltweit ihresgleichen suchen.
Die Aufwertungen erzeugen einen Zwang, ständig die Produktivität zu steigern. Da das gelingt, ohne dass es zu Arbeitslosigkeit kommt, erhöht eine solche Strategie den Wohlstand des Landes. Pro Kopf ist das Bruttoinlandsprodukt inzwischen etwa doppelt so hoch wie bei uns.
Ich denke, dass sich auch in den Problemländern des Euroraums allmählich die Einsicht durchsetzt, dass Abwertungen letztlich keine Hilfe sind. Es wird viel über den Austeritätszwang geklagt, aber es gibt keine Anzeichen dafür, dass sich einzelne Länder vom Joch des Euro befreien möchten.
An die Adresse Deutschlands gerichtet, darf das „Spardiktat“ allerdings auch nicht übertrieben werden. Der Euro sollte sich aufwerten, aber bitte in geordneten Bahnen, damit es nicht allzu dramatisch mal in die eine, dann wieder in die andere Richtung geht. Es schadet, wenn die Preissignale zu oft wechseln. Die deutsche Politik könnte eine zu starke Aufwertung und eine zu große Volatilität des Euro-Wechselkurses dadurch verhindern, dass sie zu einer expansiveren Finanzpolitik mit einem Schwerpunkt auf wachstumsfreundlichen Maßnahmen übergeht. An fiskalischem Spielraum mangelt es bekanntlich nicht. Für die schwächeren Länder bedeutet das, dass sie durch Erfolge im Außenhandel (mit den bessergestellten europäischen Ländern) rascher gesunden können. Das wäre nicht nur ein Mittel gegen gefährliche populistische Tendenzen, sondern würde auch dazu beitragen, die Spannungen innerhalb des Euroraums abzubauen und so den Euro dauerhaft zu stabilisieren.