Seit Anfang Januar bewegen sich die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen in einem engen Korridor um den Wert 0,55 Prozent. Ich kann nicht erkennen, dass sich das demnächst in der einen oder anderen Richtung ändern wird. In Europa werden sich weder die Geldmarktsätze noch die deutschen Bondrenditen nennenswert bewegen.
Es hatte am Rentenmarkt einige Ausbruchversuche in Richtung 0,8 Prozent gegeben, aber das waren immer nur kurze Episoden. Währenddessen sind die langen amerikanischen Zinsen kräftig gestiegen. Die Rendite 10-jähriger Treasuries liegt mittlerweile bei rund drei Prozent. (Real, also nach Abzug der Inflationsrate , liegt sie bei ein Prozent.) Wie der ersten Grafik zu entnehmen ist, hat sich der Renditevorsprung der US-Bonds dadurch ständig vergrößert.
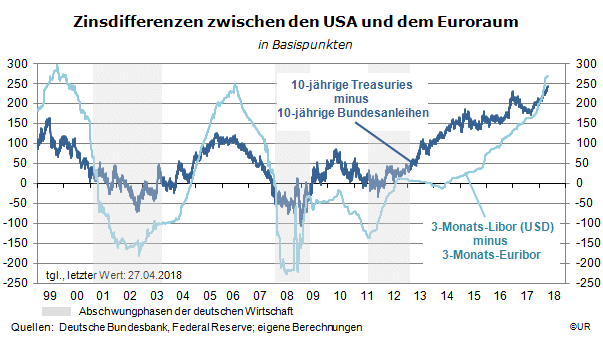
Das dürfte so weitergehen, vor allem weil die Fed plant, die Leitzinsen in Schritten von jeweils 25 Basispunkten stetig zu erhöhen – bis zum Jahresende von jetzt 1,50 bis 1,75 Prozent auf vermutlich 2,25 bis 2,50 Prozent –, während die EZB bisher noch nichts von höheren Zinsen wissen will und den Hauptrefinanzierungssatz auf absehbare Zeit bei null Prozent halten dürfte. In dem Maße, wie die Differenz in den Leitzinsen zunimmt, steigen die Refinanzierungskosten von Bondportefeuilles in den USA relativ zu den europäischen und drücken auf diese Weise auf die relativen Kurse der Treasuries (was zu steigenden Renditen führt).
Da die Renditedifferenzen mindestens seit Einführung des Euro Anfang 1999 so stark schwanken, gibt es de facto keine Korrelation mehr zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Markt. Eine solche Emanzipation ist an den Aktienmärkten bisher nicht zu erkennen; da gilt weiterhin, dass die USA die Richtung vorgeben.
Die fehlende – oder geringe – Korrelation der Bondrenditen bedeutet für Anleger, die sich auf festverzinsliche Wertpapiere spezialisieren, dass sie ihr Risiko vermindern können, indem sie sich auf beiden Märkten engagieren, dem amerikanischen und dem europäischen.
Dass sich die US-Zinskurve über das gesamte Laufzeitenspektrum hinweg nach oben bewegt, hat damit zu tun, dass der Konjunkturaufschwung inzwischen neun Jahre alt ist und die Kapazitätsreserven nicht mehr so groß sind. Die Arbeitslosenquote in den USA liegt nur noch bei knapp über vier Prozent! Langsam scheint die Lohninflation in Gang zu kommen, und die Inflationsrate hat im März ihren Zielwert von zwei Prozent erreicht (gemessen am Preisinderx des privaten Verbrauchs). Nichts spricht dagegen, dass die Fed die Zügel weiter anziehen wird. Sie möchte ja auch Spielraum haben, wenn die nächste Rezession ins Haus steht.
Zusammen mit den zunehmenden Inflationserwartungen und der Aussicht, dass die staatlichen Defizite auf eine Billion Dollar oder mehr steigen werden, also auf über fünf Prozent des BIP, ergibt das ein ziemlich konsistentes Bild. Sowohl die Leitzinsen als auch die langen Bondrenditen werden weiter steigen.
Im Euroland ist die Situation in mancher Hinsicht ganz anders. Nur die Zuwachsraten des realen BIP sind ähnlich hoch. Aber der Aufschwung ist gerade einmal gut fünf Jahre alt, die Arbeitslosenquote liegt noch bei 8,5 Prozent und die Inflation macht angesichts erheblicher Kapazitätsreserven und einer starken Währung keine Anzeichen, sich ihrem Zielwert zu nähern – im April übertraf der harmonisierte Verbraucherpreisindex seinen Vorjahresstand voraussichtlich um nur 1,2 Prozent, die sogenannte Kernrate den Ihren um 0,8 Prozent. Es geht eher nach unten als nach oben. Außerdem lässt die Kreditvergabe an den privaten Sektor weiterhin zu wünschen übrig. An den inflationsgeschützten Staatsanleihen Deutschlands, Frankreichs und Italiens lässt sich ablesen, dass die Marktteilnehmer für die nächsten zehn Jahre mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von weniger als 1,3 Prozent rechnen. Warum sollte die EZB die Zinsen erhöhen? Und warum sollten die Bondrenditen in einem solchen Umfeld steigen? Die EZB muss, und wird, weiter Gas geben.
Zum Schluss noch eine Anmerkung zum Zusammenhang zwischen Geldmarktzinsen und Wechselkurs. Gewöhnlich wird argumentiert, dass der Dollar gegenüber dem Euro aufwertet, wenn die Zinsdifferenz zunimmt, und umgekehrt. Wie das nächste Schaubild zeigt, ist das manchmal der Fall, zu anderen Zeiten aber nicht.
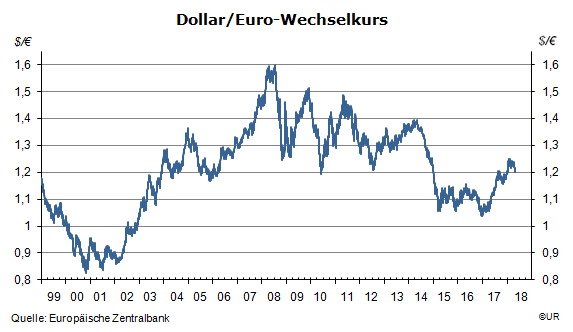
1. Obwohl der Zinsspread von Dollar-Libor zu Euribor ab Ende 1999 stark zurückging und ab Anfang 2001 sogar in den negativen Bereich rutschte (vgl. die erste Grafik), wertete der Euro entgegen der Theorie nicht auf, sondern ab.
2. Im Jahr 2008 stimmte es wieder: Die Dollarzinsen waren um bis zu 200 Basispunkten unter die Eurozinsen gefallen, und der Euro hatte fast 1,60 Dollar erreicht, seinen bisherigen Höchstwert.
3. Seit Mitte 2014 kam es relativ zu den Eurozinsen zu einem starken Anstieg der Dollarzinsen, was anfangs lehrbuchgerecht zu einer Euroabwertung führte (von 1,40 Dollar auf 1,05 Dollar), seit Anfang 2017 aber wertete der Euro wieder auf (gestern lag er bei 1,20 Dollar), obwohl sich die Zinsdifferenz deutlich zugunsten des Dollar ausweitete – was dann nicht mehr lehrbuchgerecht war.
Mit anderen Worten, Prognosen des Wechselkurses, die vor allem auf Veränderungen des Zinsspreads abstellen, sind sehr unzuverlässig, taugen also in der Praxis nicht viel. Erfahrungsgemäß sollte auch das Niveau des Wechselkurses berücksichtigt werden, also die Kaufkraftparität, dazu die Entwicklung der Leistungsbilanzen sowie gegebenenfalls Safe Haven-Effekte im Verlauf von politischen Krisen. Eindimensionale Ansätze wie die Zinsdifferenz führen häufig in die Irre.