Am 26. September wird die Fed voraussichtlich ihren Leitzins. die Federal Funds Rate, um 25 Basispunkte auf 2,00 – 2,25 Prozent anheben, und am 19. Dezember noch einmal um diesen Betrag. Das sind schlechte Nachrichten für die Schwellenländer und alle, die ihnen Geld geliehen haben.
Angesichts der robusten Konjunktur in den USA, Inflationsraten zwischen 2,0 Prozent (Kernrate) und 2,9 Prozent (CPI) sowie einer mehr als lockeren Finanzpolitik sind die amerikanischen Zinsen immer noch niedrig – zu niedrig. Für viele Schwellenländer könnte sich der Zinsanstieg dagegen als katastrophal erweisen: Da sie hohe kurzfristige Dollarschulden haben, verteuert sich ihr Schuldendienst dramatisch. Bis zum Dezember 2015 betrug die Funds Rate lediglich 0 – 0,25 Prozent; der 3-Monatssatz für Interbankengeld (Dollar-LIBOR) hat sich seit dem Herbst 2015 bereits analog zur Funds Rate von 0,34 Prozent auf 2,32 Prozent erhöht, also fast um das Siebenfache. Hinzu kommt neuerdings in den meisten Fällen eine starke Abwertung gegenüber dem Dollar, was den Schuldendienst weiter erschwert.
In die Schusslinie sind an den Märkten vor allem die Länder geraten, die sowohl im Staatshaushalt als auch in der Leistungsbilanz hohe Defizite aufweisen (sogenannte twin deficits), vorneweg Argentinien, die Türkei und Brasilien. Wie die Tabelle zeigt, ist die Liste der potenziellen Krisenländer aber viel länger.
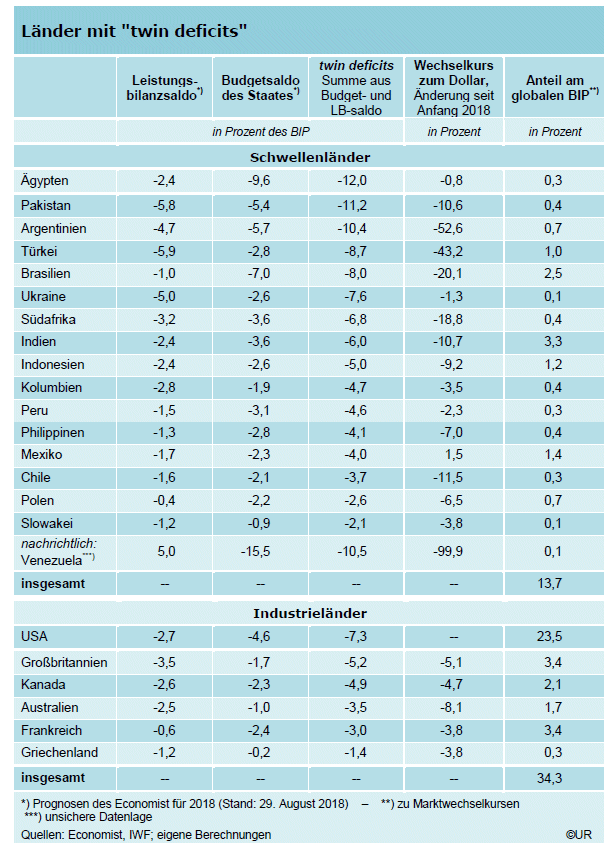
Einige der reicheren Länder, wie die USA und Großbritannien, weisen zwar ebenfalls twin deficits auf, werden aber keine Probleme beim Schuldendienst haben, weil sie (netto) fast ausschließlich in ihren eigenen Währungen verschuldet sind und über unabhängige Notenbanken verfügen, die jederzeit neues Geld drucken können. Ihnen drohen höchstens Abwertungen, aber damit haben sie aus heutiger Sicht nicht nur keine Probleme, sondern würden sich darüber freuen. Warum? Weil das ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und den Prozess der De-Industrialisierung stoppen würde. Donald Trump lässt grüßen.
Alle Elemente einer ausgewachsenen Schuldenkrise sind in den Schwellenländern der obigen Tabelle inzwischen vorhanden. Es ist wie im Lehrbuch, eine Kombination aus hohen Gesamtschulden – einschließlich inländischer Schuldenblasen, Prestigeprojekten wie Flughäfen oder Wolkenkratzern –, steigenden Dollarzinsen und immer hektischerer Finanzspekulation. Dazu ein unterkapitalisierter Bankensektor, staatliche Haushaltsdefizite, negative Salden in den Leistungsbilanzen, beträchtliche kurzfristig fällige Schulden in Fremdwährungen, vor allem in Dollar, sowie unzureichende Devisenreserven, eine schmale industrielle Basis, Abhängigkeit von Rohstoffexporten, Korruption, schwache staatliche und private Institutionen und eine unterentwickelte Infrastruktur. Manchmal frage ich mich, warum solche Länder überhaupt wachsen können.
Das Washingtoner Institute of International Finance berichtet, dass sich die Fremdwährungsschulden der Schwellenländer seit dem Vorkrisenjahr 2007 bis Ende 2017 von 4,3 Bill. Dollar auf 8,2 Bill. Dollar fast verdoppelt haben (das BIP der Schwellenländer lag zuletzt bei etwa 30 Bill. Dollar). Von heute bis Ende 2019 kommen auf die Schwellenländer Fälligkeiten von etwa drei Bill. Dollar zu (Bonds und syndizierte Kredite).
Die Zinsen in Amerika und Europa waren lange Zeit einfach unschlagbar niedrig, vor allem im Vergleich zu den Renditen in Ländern, die sich im rapiden wirtschaftlichen Aufholprozess befinden. Nichts war naheliegender als die Strategie, sich in den reichen Ländern zu einem Zins von nahe Null zu verschulden und das Geld in Schwellenländern anzulegen, wo die Wachstumsraten des realen BIP Jahr für Jahr um die Marke von fünf Prozent pendelten.
Inzwischen nähert sich die Niedrigzinsphase in den USA ihrem Ende, und es ist absehbar, dass Euroland in etwa einem Jahr ebenfalls auf eine restriktivere Geldpolitik einschwenken wird. Der vergleichsweise geringe Anstieg der amerikanischen Zinsen hat bereits ausgereicht, mehrere große Schwellenländer an den Rand ihrer Zahlungsfähigkeit zu bringen. Die Lage wird sich vermutlich noch für vielleicht zwei Jahre verschlechtern, bevor sie sich wieder bessert, es sei denn, es kommt schon vorher zu einem Knall. Der Handelskrieg zwischen den USA, China und Europa, die Sanktionen gegen Russland und den Iran oder ein starker Anstieg des Ölpreises durch einen neuen Krieg im Nahen Osten könnten die Auslöser sein.
Wenn ein Schwellenland Probleme mit seinem Schuldendienst hat, wird es in der Regel versuchen, die Inlandsnachfrage durch hohe Zinsen und eine restriktive Finanzpolitik zu dämpfen und auf diese Weise Ressourcen für Exporte freizumachen. Nur durch eine Exportoffensive und den Verkauf inländischen Vermögens an Ausländer lassen sich die Schulden vermindern. Eine Rezession, verbunden mit einem Einbruch der Aktienmärkte, ist die logische Folge. Das trägt dann ebenfalls zum Ende des bisherigen Erfolgsmodells bei, nämlich der Verschuldung in kurzen Dollars und des Erwerbs realer Aktiva in Schwellenländern.
Umschuldungen und Hilfsersuchen an den IWF werden für’s Erste die Nachrichten beherrschen. Glücklicherweise haben die Krisenländer „nur“ einen Anteil von 13,7 Prozent am globalen BIP, wenn ich, wie in der Tabelle geschehen, China außen vor lasse, weil das Land die zweitgrößten Währungsreserven der Welt hält, über einen riesigen Binnenmarkt verfügt und so gut wie keine Auslandsschulden hat.
Absehbar ist darüber hinaus, dass es Schwierigkeiten bei den Gläubigern der Krisenländer geben wird. Das betrifft in erster Linie international tätige Banken. Zumindest die europäischen unter ihnen sind noch nicht ausreichend kapitalisiert, und ihre notleidenden Kredite sind nach wie vor beunruhigend hoch. Das ist deswegen beunruhigend, weil die neue Krise in den Schwellenländern gerade erst begonnen hat. Probleme wird es auch bei Industrieunternehmen geben, die in diesen Teil der Welt exportieren. Wenn sie dagegen dort in der Vergangenheit Produktionsstätten geschaffen haben, können sie sich freuen. In Dollar oder Euro gerechnet sind die Kosten in der Türkei, in Brasilien, Argentinien oder Südafrika so stark gesunken, dass sich Marktanteile gewinnen lassen.
Insgesamt sieht es nicht gut aus. Es wird demnächst wohl wieder eine Flucht in „sichere“ Anlagen geben, die Zinsspreads zwischen europäischen Bondmärkten dürften wieder einmal auseinander gehen. Eine größere Korrektur der europäischen und amerikanischen Aktienmärkte rückt näher.