Der Fall Italien zeigt: Die Schulden- und Defizitregeln des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts müssen von Grund auf reformiert – oder abgeschafft werden. So wie die Buchhaltungsabteilung einer Firma nicht deren Strategie bestimmen sollte, so wenig sollten die Haushaltsregeln von Maastricht über die Zukunft der Europäischen Union entscheiden.
Das tun sie aber. Sie reflektieren vor allem Eins: die Furcht der reichen Länder im Norden, dass sie im Ernstfall für die Schulden der Anderen, der Länder im Süden, aufkommen müssen. Der Euro kann eine existenzielle Krise nur überleben, wenn einer dem anderen hilft und es keinen Zweifel an der Solidarität gibt, wie in einer Familie. Damit das nicht ausgenutzt wird und es erst gar nicht zu Schuldenkrisen kommt, wollten die mutmaßlichen künftigen Gläubiger wenigstens vertraglich und sanktionsbewehrt zugesichert bekommen, dass alle sparsam wirtschaften und sich stets nur wenig neu verschulden. Herausgekommen sind die 60%-Schuldenregel und die 3%-Defizitregel, beide einfach zu verstehen, auch für Juristen, aber dennoch ein wichtiger Grund, weshalb die Wirtschaft Eurolands so langsam wächst und die Populisten so viele Stimmen bekommen.
In Italien haben die Regeln vor allem eins bewirkt: dass sie den Staat daran gehindert haben, die große Lücke zwischen dem tatsächlichen und dem potenziellen Bruttoinlandsprodukts mit seiner Nachfrage mindestens teilweise zu füllen und auf diese Weise mehr Wachstum und Beschäftigung zu schaffen. Seit zwanzig Jahren stagniert dort die Wirtschaft, die Arbeitslosenquote beträgt immer noch 10,2 Prozent, während die EU-Kommission ungerührt weiterhin behauptet, dass de facto Vollbeschäftigung herrsche, wenn sie dem Land für das kommende Jahr eine Outputlücke von lediglich 0,1 Prozent des Produktionspotenzials bescheinigt, und die Finanzpolitik daher ihre Budgetdefizite vermindern müsse. Matteo Salvini von der Lega wirkt deshalb glaubwürdig, wenn er die Kommission und die Mitgliedschaft in der EU für die andauernde Misere des Landes verantwortlich macht. Ein großer Teil der italienischen Wähler wünscht sich endlich mehr finanzpolitische Autonomie und unterstützt Salvini bei seinem Kampf gegen „Brüssel“.
Der Streit könnte leicht entschärft werden, wenn die Kommission zugeben würde, dass ihr Konzept der Vollbeschäftigung revidiert werden muss. De facto ist die Outputlücke viel größer als „offiziell“ ausgewiesen. In einem sorgfältig argumentierenden Beitrag für den MAKRONOM hat der österreichische Ökonom Philipp Heimberger vor einigen Tagen gezeigt, dass Italiens BIP im Jahr 2019 nicht um 0,3 Prozent unter seinem Potenzial liegt – wie es die EU-Kommission behauptet –, sondern vielmehr um acht bis 16,5 Prozent, je nach den Annahmen, die man darüber trifft, wie sich die Produktionsmöglichkeiten der italienischen Wirtschaft seit der tiefen Rezession von 2008/2009 entwickelt haben.
Wird das frühere Trendwachstum von 1,5 Prozent fortgeschrieben, ergibt sich eine Lücke zwischen dem, was ist und dem, was sein könnte, von 16,5 Prozent. Akzeptiert man dagegen, dass es infolge der Krise zu einem Strukturbruch (genannt „Hysterese“) gekommen ist und sich das Potenzialwachstum (aus rätselhaften Gründen) seitdem auf jährlich 0,5 Prozent verlangsamt hat, bleibt für 2019 immer noch eine Outputlücke von acht Prozent.
Wie könnte die EU-Kommission auf eine noch niedrigere Wachstumsrate des Potenzials kommen? In der ersten der beiden folgenden Grafiken erkennt man, dass das reale BIP des Landes seit etwa 2000 nicht mehr zugenommen hat, anders als in Spanien, Frankreich und Deutschland.
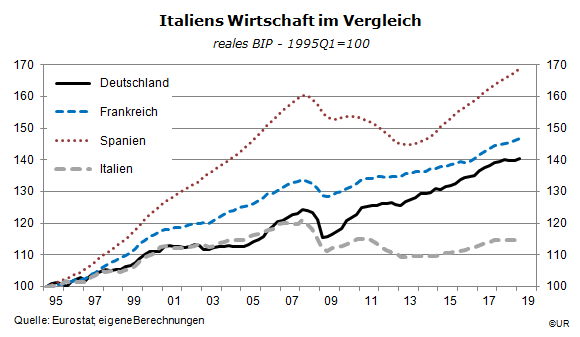
Die nächste Grafik zeigt, dass die Kommission für das Jahr 2000 noch ein Wachstum des italienischen Produktionspotenzials von 1,5 Prozent errechnet hatte.
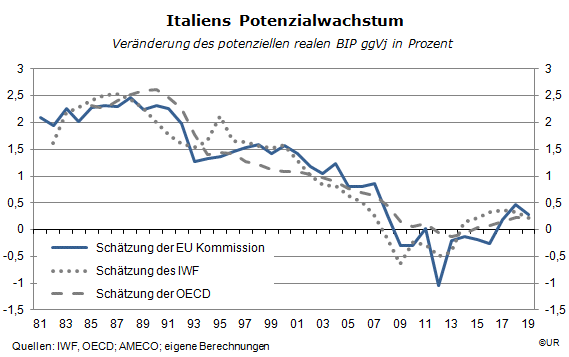
So wie das tatsächliche BIP-Wachstum immer mehr nachließ, hat die Kommission im Laufe der Zeit auch das Wachstum des Potenzials reduziert. Die Ergebnisse schwanken, wie man sieht, sehr stark von Jahr zu Jahr, einschließlich negativer Zuwachsraten im Zeitraum 2009 bis 2016. Das ist nicht plausibel. Grundsätzlich entwickelt sich das Produktionspotenzial sehr stetig und reagiert nur träge auf das konjunkturelle Auf und Ab. Weder das Angebot an Arbeitskräften noch der Kapitalstock und die Produktivität bewegen sich stark von einem Jahr auf’s andere. Das Produktionspotenzial Italiens folgt dagegen bei der Kommission sehr eng dem tatsächlichen BIP (vergleichbar einem gleitenden 5-jährigen Durchschnitt). Das ist ein Widerspruch in sich. Der IWF und die OECD verfahren ebenso (wie die Grafik zeigt) – was die Sache aber nicht besser macht.
Insgesamt komme ich mit Philipp Heimberger zu dem Schluss, dass Italiens Wirtschaft weit unter ihren Möglichkeiten operiert. Das dürfte im Wesentlichen Folge der schlichten und offensichtlich falschen Rezepte sein, die Brüssel verordnet hat. Wenn die Outputlücke tatsächlich so gewaltig ist, wie sie von Heimberger berechnet wird, müsste die Kommission die Regierung ermutigen, eine deutlich expansivere Finanzpolitik zu verfolgen und bis auf Weiteres viel höhere Budgetdefizite zuzulassen.
Italien hat, wie ich im vergangenen Oktober gezeigt habe, keine Probleme mit dem Schuldendienst – er macht nur noch etwa dreieinhalb Prozent des BIP aus, nach rund fünf Prozent vor zehn Jahren. Eine expansive Finanzpolitik lässt sich ja als Wachstumspolitik ausgestalten, denn Italien hat offenbar wirklich Probleme mit seiner Wirtschaftsstruktur, Investitionen und Innovationen.
Die Belastung durch die Schulden wird sich, relativ gesehen, in den kommenden Jahren im Übrigen weiter vermindern, da die Bondrenditen angesichts stark rückläufiger Inflationserwartungen erneut im freien Fall sind. Deflation ist schon wieder ein Thema.