Offenbar haben wir es für die Wirtschaftspolitiker nur dann mit einer Rezession zu tun, wenn die Zuwachsrate des realen BIP im Vorjahresvergleich ein negatives Vorzeichen hat. Der Internationale Währungsfonds hat gerade vorhergesagt, dass Euroland in diesem und nächsten Jahr um 1,3 Prozent und 1,6 Prozent expandieren wird (Deutschland um 0,7 Prozent und 1,7 Prozent). Das deckt sich vermutlich mit den internen Prognosen der EZB. Danach haben wir es lediglich mit etwas schwächerem Wachstum zu tun. Gegen eine Rezession sprächen die nach wie vor rasche Zunahme der Beschäftigung – zuletzt 1,3 Prozent im Vorjahresvergleich, auf 160 Mio Erwerbstätige – , der kräftige Anstieg des durchschnittlichen Haushaltsvermögens infolge steigender Immobilienpreise, Aktienkurse und Bondpreise, die robuste Baunachfrage und der stabile Dienstleistungssektor, sowie die neuerdings leicht expansive Fiskalpolitik. Ein Problem, so Draghi am Donnerstag, gäbe es in Ländern wie Deutschland und Italien, in denen das verarbeitende Gewerbe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Hier habe man es aber mit einem „idiosynkratischen Schock“ zu tun, als Folge der Sonderfaktoren „Trump“ und „Brexit“, die den internationalen Handel und die Unternehmensinvestitionen beeinträchtigen.
Trotzdem waren Konjunktursorgen in der Pressekonferenz der EZB und Draghis einleitenden Bemerkungen das beherrschte Thema. Draghi lehnte es zwar ab, darüber zu spekulieren, wann die Leitzinsen wieder steigen könnten, aber mindestens bis Mitte 2020 sollen sie auf dem jetzigen Niveau bleiben, oder unterhalb davon, jedenfalls so lange, bis ein nachhaltiger Anstieg der Inflationsrate auf knapp unter zwei Prozent erreicht ist. Ein neues Thema ist die Symmetrie des Inflationsziels. Der EZB Rat will damit signalisieren, dass er eine zu geringe Inflation genauso entschlossen bekämpft wie eine zu hohe. Jedenfalls soll potenziellen Schuldnern die Angst vor steigenden Zinsen genommen werden, während Sparer vom Kontensparen abgehalten werden sollen. Dass die Inflation auch im Jahr 2021 nur bei 1,6 Prozent liegen wird, wie allgemein vorhergesagt, hält er nicht für akzeptabel und wird alles in seiner Macht stehende tun, damit am Ende eine höhere Rate herauskommt.
Mehrere Ausschüsse des Eurosystems sollen demnächst Vorschläge unterbreiten, wie die Geldpolitik noch expansiver gestaltet werden kann, nachdem es bei den Zinsen praktisch keinen Spielraum mehr gibt. Bei der nächsten Sitzung der EZB am 12. September wird es beim Einlagesatz voraussichtlich eine Reduktion von jetzt -0,4 Prozent auf -0,5 oder -0,6 Prozent geben, aber das dürfte nur eine Komponente in einem größeren Paket sein. Diskutiert wird, wie sich die sogenannte forward guidance betreffend die künftigen Zinsen glaubhafter gestalten lässt, wie sich die Bankengewinne im Nullzinsumfeld stabilisieren lassen, und wie ein mögliches neues Ankaufprogramm von Wertpapieren hinsichtlich seines Volumens und seiner Zusammensetzung ausgestaltet werden könnte. Alle Ampeln stehen auf Grün.
Das ist auch angebracht. Auf der Pressekonferenz betraf eine Frage die Wirksamkeit der bisherigen Maßnahmen: Da sie nichts gebracht hätten, wäre von der nächsten Runde wahrscheinlich auch nicht viel zu erwarten. Erwartungsgemäß widersprach Draghi dieser Auffassung, schließlich sei die Inflationsrate angestiegen und die Arbeitslosigkeit stark zurückgegangen. Mit den Maßnahmen hätte die Geldpolitik die Bedingungen für eine höhere Inflation geschaffen, allerdings wirke der Kostendruck auf die Preise langsamer als erwartet. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Situation ohne die geldpolitischen Gegenmaßnahmen höchstwahrscheinlich noch unerfreulicher wäre.
Wie die folgende Grafik zeigt, sinkt die Stimmung in der Wirtschaft gerade ähnlich stark wie in den Jahren 2011 und 2012.. Damals kam es in der Folge zu einer fast zweijährigen Stagnation des Euroland-BIPs. Da es auf absehbare Zeit weder im internationalen Handelsstreit noch in Sachen Brexit Entwarnung geben dürfte, könnten die Frühindikatoren weiter fallen. Eine Wende ist nicht in Sicht.
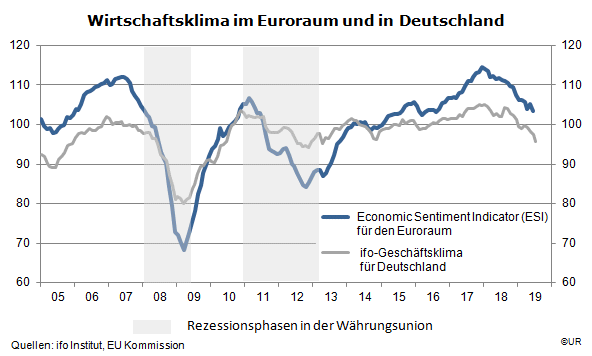
Das wiederum bedeutet, dass sich die Outputlücken vergrößern und die Inflationsrate eher fallen als steigen dürfte, womit das Ziel der EZB in immer weiterer Ferne entschwindet. Draghi mahnt zurecht immer dringlicher einen größeren Beitrag der europäischen Fiskalpolitik an. Die EZB allein kann es nicht schaffen.
Das aggregierte Haushaltsdefizit der Euroländer wird in diesem Jahr voraussichtlich nur bei 1,2 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts liegen und damit viel niedriger sein als es nach den Maastricht-Regeln möglich wäre. Klar, das ist eine formal unzulässige Aussage, denn es gibt bisher keine gemeinsame Fiskalpolitik – jedes Land kämpft auf dem Gebiet für sich allein. Trotzdem besteht nach der jahrelangen Austeritätspolitik erheblicher Spielraum für eine notfalls massive Expansion der staatlichen Nachfrage, ebenso wie für Steuersenkungen.
Es muss ja nicht alles dem Konsum zugutekommen. Aber warum nicht die Wachstumskräfte stärken, also mehr dafür tun, dass die Produktivität endlich wieder in Schwung kommt? Angesprochen fühlen sollten sich vor allem Deutschland, die Niederlande und Österreich, die allesamt Haushaltsüberschüsse aufweisen. Sogar Griechenland könnte sich wieder Defizite leisten. So konkret kann Draghi natürlich nicht werden, aber die Politiker, die seine heutigen Aussagen und seine Analyse der Situation genauer studieren, dürften wissen, wer gemeint ist. Wenn immer nur gespart wird, kann es kein Wachstum geben – und auch keine Inflation. Japan sollte nicht als Vorbild dienen.