Lange hatte ich befürchtet, dass es auch bei uns demnächst zu einer echten Deflation kommen könnte. Das glaube ich inzwischen nicht mehr. Die Inflation wird zwar auf absehbare Zeit niedrig bleiben – weil sich zum Einen die Lücke zwischen Nachfrage und Produktionspotential nur langsam schließt und weil zum Anderen wegen des festen Euro Preisstabilität importiert wird -, eine echte Deflation im Sinne, dass das Preisniveau viele Jahre lang sinkt, wird es aber nicht geben. Ich kann mir gut eine Deflation in Ländern wie Irland, Griechenland, Portugal und Spanien vorstellen, aber nicht in Deutschland, und auch nicht im Euroraum insgesamt.
Was ist eigentlich gegen Deflation einzuwenden? Warum soll nicht die Kaufkraft des Geldes auch mal steigen statt immer nur abzunehmen? Im vergangenen Jahr hatte die japanische Notenbank private Haushalte befragt, was sie denn von der hartnäckigen Deflation hielten. Erstaunlicherweise war die Reaktion deutlich positiv: toll, dass alles immer billiger wird! Offenbar ist es so, dass sich ganz gut mit einem leicht sinkenden Preisniveau leben lässt, vorausgesetzt, dass sich daraus keine Abwärtsspirale entwickelt und man davon ausgehen kann, dass die leichte Deflation einige Jahre lang anhalten wird. Also Hauptsache, man kann sich darauf einstellen. So ist es in Japan inzwischen.
Es lohnt immer, sich die japanischen Zahlen mal genauer anzusehen. In den Jahren seit 1995, fünf Jahre nach dem Platzen der Aktienblase und zwei Jahre nach dem Platzen der Immobilienblase – als das Preisniveau dauerhaft zu sinken begann -, lag die durchschnittliche Inflationsrate bei – 0,1 Prozent, mit relativ geringen Schwankungen um diesen Wert. Rechnet man die kräftige Erhöhung der Umsatzsteuer vom Jahr 1997 heraus (das staatliche Defizit war damals aus Sicht der Politiker zu groß geworden!), ergibt sich ein Wert von -0,3 Prozent. Im vergangenen Aufschwung, der 2008 endete, sah es kurzzeitig nach einer Rückkehr zu etwas höheren Inflationsraten aus, seitdem hat sich die Deflation aber wieder festgesetzt. Nachdem die Verbraucherpreise 2009 um 1,4 Prozent gesunken waren, dürften sie 2010 noch einmal um 1,0 Prozent zurückgehen; auch für 2011 wird allgemein eine milde Deflation vorausgesagt.
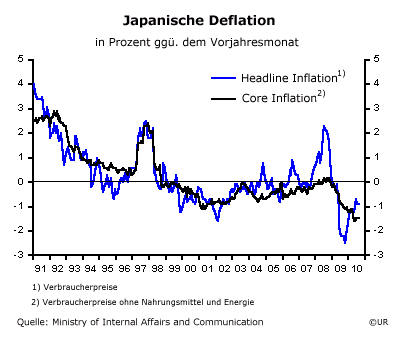
Die Notenbank ist seitens der Regierung unter Druck, etwas dagegen zu tun. Das Wirtschaftswachstum will einfach nicht in Gang kommen, wenn die Preise immer nur sinken. Während Inflation diejenigen begünstigt, die sich verschulden – also etwas unternehmen und Risiken eingehen! -, ist Deflation gut für die Sparer, die Alten, die Vorsichtigen, die „Couponschneider“.
In der Tat, seit das japanische Preisniveau nicht mehr steigt, nimmt das reale Sozialprodukt kaum noch zu. Seit 1992 waren es im Jahresdurchschnitt nur 0,8 Prozent, während es bis dahin rund 4 Prozent waren. Dass da ein direkter Zusammenhang besteht, lässt sich am Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote ablesen, denn Investitionen werden in der Regel überwiegend mit geliehenem Geld finanziert. Das Wachstum des Produktionspotentials und damit des Lebensstandards hängt davon ab, wie viel investiert wird. Am dramatischsten war der Rückgang des Wohnungsbaus: Verglichen mit den Werten der frühen neunziger Jahre sind die Investitionen in diesem Bereich real um 60 Prozent niedriger. Die Hypothekenschulden sind immer noch eine schwere Last.
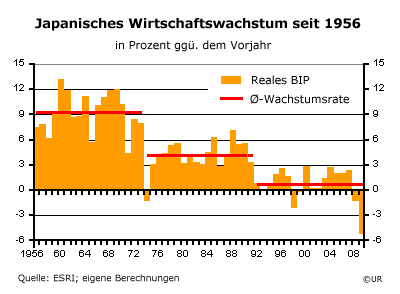
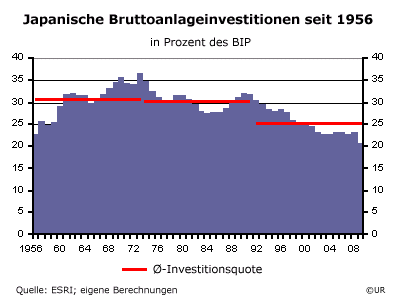
Was ein Anspringen des Wirtschaftswachstums und der Inflation nach wie vor behindert sind zwei sogenannte Vermögenseffekte: der Marktwert der inländischen Aktien beträgt gerade mal 23,6 Prozent des Werts von Ende 1989, und die Preise für Häuser und Wohnungen sinken nach wie vor – sie haben sich seit 1992 halbiert. Die Leute fühlen sich arm und wagen kaum noch, neue Schulden aufzunehmen.
Warum gibt es eigentlich nur in Japan Deflation? Im Jahr 2009 sind die Preisniveaus auch in anderen Volkswirtschaften zurückgegangen, aber das waren immer nur kurze Episoden. Wer „Deflation“ sagt, hat etwas Dauerhaftes im Sinn. Nach dem heutigen Stand der Erkenntnis kommt es dazu nur im Gefolge von Blasen an den Märkten für Aktien, Immobilien, Devisen oder Rohstoffen, die wiederum vor allem schuldenfinanziert sein müssen. Nirgendwo lässt sich das besser beobachten als in Japan.
Es muss eine so euphorische Stimmung herrschen, dass bedenkenlos Schulden für den Kauf von Aktien oder Immobilien aufgenommen werden. Blasen ohne Schulden, also nur auf der Basis von Eigenmitteln, gibt es nicht. Deflation kommt zustande, wenn die Schulden deutlich höher sind als der Marktwert der Dinge, die einst auf Pump gekauft wurden, oder wenn, was genauso gefährlich ist, Autos oder Ferienreisen in großem Stil per Kreditkarte bezahlt wurden und auf einmal der Arbeitsmarkt einbricht. Dann ist Sparen angesagt. Je größer der Absturz, je übertriebener die Preise und Kurse einst waren, und je größer die Schulden im Vergleich zum Einkommen, desto länger dauert es, bis wieder Normalität erreicht ist, bis die Leute sich wieder schuldenfrei fühlen und beginnen, nicht mehr jeden Pfennig umzudrehen, bevor sie ihn ausgeben. In Japan dauert es auch deswegen so lange, weil die Banken angesichts der extrem niedrigen Zinsen sehr großzügig mit der Verlängerung ihrer Kredite sind, nach dem Motto, besser ein geringer oder auch gar kein Zinsertrag als eine gewinnmindernde Abschreibung.
All das beschreibt nicht, was wir in den vergangenen Jahren in Deutschland erlebt haben. Im Economist von letzter Woche gab es eine Tabelle mit Hauspreisindikatoren. Danach waren die Hauspreise von 1997 bis 2010 in einigen großen Ländern im hohen zweistelligen oder sogar dreistelligen Prozentbereich gestiegen: USA 65 bis 102, Großbritannien 181, Frankreich 141, Italien 94, Spanien 157 Prozent. Für Deutschland gibt es in dieser Tabelle über diesen Zeitraum keine Angabe. Nach einer Zeitreihe der OECD sind die Hauspreise in Deutschland zwischen 1997 und 2008 aber um rund 6 Prozent gefallen. Noch beruhigender ist, dass deutsche Immobilien auf der Basis von Mieten zu Marktpreisen um 12,9 Prozent unterbewertet sind. Da gibt es keine Blase, die platzen könnte (ebenso wie in der Schweiz und in Japan). In Spanien sind die Preise dagegen nach wie vor sehr hoch, ebenso wie in Großbritannien und – erstaunlicherweise – in Frankreich.
Für den Euroraum insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild: Gewogen mit den Anteilen am Sozialprodukt der Währungsunion komme ich im Vorjahresvergleich bei den Hauspreisen zu einer Inflationsrate von moderaten 2,3 Prozent, und zu einer Überbewertung der Immobilien von 18,2 Prozent. Danach hätten wir es hier mit einem positiven Vermögenseffekt zu tun. Es droht aus dieser Ecke also weder eine große Blasen-platz-Gefahr noch eine Deflationsgefahr. Die EZB betont zu Recht, dass sie bei ihren Zinsentscheidungen immer nur auf das Aggregat schaut, nicht auf die regionalen Entwicklungen. Die spanischen und französischen Preise mögen deutlich überhöht sein und weiter zurückgehen oder endlich kräftig fallen – wie im Fall Frankreich -, daraus lässt sich aber nicht ableiten, dass starke deflationäre Effekte zu befürchten sind
Wie sieht es bei den Aktien aus? In der jüngeren Vergangenheit gab es in der Währungsunion zwei Situationen, in denen es nach Euphorie und Blasen roch: im Jahr 2000 und dann wieder um die Jahresmitte 2007. Heute liegen die Aktienindices weit unter ihren damaligen Höchstständen: Mailand -56,8 Prozent, Paris -44,0 Prozent, Madrid -32,4 Prozent, Frankfurt, relativ bescheiden, -18,6 Prozent. Ich glaube nicht, dass die Kurse noch einmal einbrechen werden, vielleicht mit der Ausnahme von Spanien. Die Kurs-/Gewinnrelationen bewegen sich auf der Basis der geschätzten Gewinne für 2010 in den vier Märkten in der Spanne von 10,7 bis 12,7, sind also historisch gesehen sehr billig. Auch im Verhältnis zu den Renditen langlaufender Staatsanleihen sind sie eher unterbewertet.
Da der Aktienbesitz eine relativ geringen Anteil am Vermögen der Haushalte hat (vor allem im Vergleich zu Amerika, wo der Wert der Aktienportefeuilles von 2007 auf 2008 von 137,3 Prozent auf 86,3 Prozent des verfügbaren Einkommens eingebrochen war) dürfte der Rückgang der Aktienkurse keine schockartigen Effekte auf die Ausgabenpläne der europäischen Haushalte gehabt haben. Das spricht ebenfalls dagegen, dass Deflation für die Währungsunion als Ganzes ein echtes Risiko darstellt.
Das zeigt sich im Übrigen auch an den Inflationserwartungen. Es gibt keine Hinweise, dass sie sich in Richtung Null in Bewegung gesetzt hätten. Wenn ich die Rendite der inflationsgeschützten Bundesanleihe mit Fälligkeit April 2020 von 0,78 Prozent mit der der „normalen“ zehnjährigen Bundesanleihe von 2,56 Prozent vergleiche, komme ich auf eine Differenz von 1,78 Prozentpunkten – mit einer solchen durchschnittlichen Inflationsrate rechnen die Anleger zur Zeit. Die EZB schreibt, dass die Inflationserwartungen bei knapp unter Zwei „fest verankert“ sind. Die aktuelle Inflation befindet sich im Übrigen ebenfalls in dieser Größenordnung.
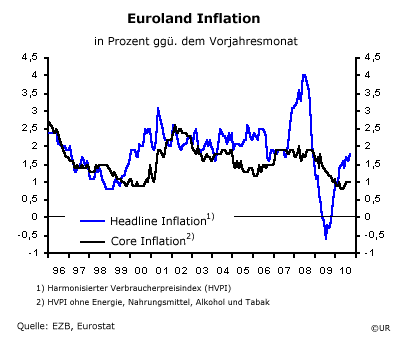
Allein die sogenannte Kerninflationsrate (HVPI ohne Energie und Nahrungsmittel) liegt im Vorjahresvergleich bei nur 1,0 Prozent und könnte ein Frühindikator dafür sein, wo es mit den Verbraucherpreisen hingehen kann. Das dürfte die EZB beunruhigen und einer der Gründe dafür sein, dass sie die Zinsen vorläufig nicht erhöhen wird, abgesehen davon, dass der Bankensektor und die Länder des Club Med nach wie vor wackeln. Eine möglichst steile Zinskurve, also niedrige Geldmarktsätze und deutlich höhere Langfristzinsen sowie insgesamt niedrige Realzinsen sind bis auf Weiteres situationsgerecht.
Die EZB würde die Zinsen nur dann erhöhen, wenn sich gleichzeitig die Konjunktur deutlich erholen und der Wechselkurs des Euro einbrechen würde. Handelsgewogen liegt der Euro bereits um rund 9 Prozent über dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre, so dass in dieser Hinsicht kein Handlungsbedarf besteht, zumal, wie täglich zu hören, ein Währungskrieg im Gange ist. Wenn alle anderen aus Wettbewerbsgründen abwerten, oder es versuchen, sollte der Euro nicht durch Zinserhöhungen zusätzlich in die Höhe getrieben werden: Ein Rückgang der europäischen Außenhandelspreise ist ohnehin vorprogrammiert.
Andererseits ist die Konjunktur keineswegs so robust, wie es aus deutscher Sicht scheint. Der Internationale Währungsfonds hat für Euroland in seinem jüngsten World Economic Outlook für 2010 und 2011 Zuwachsraten von 1,7 und 1,5 Prozent prognostiziert, was ja nichts anderes bedeutet als dass die Produktionslücke weiter zunimmt – die EZB siedelt die mittelfristige Wachstumsrate so viel ich weiß immer noch bei etwas über 2 Prozent an. Das bedeutet unter anderem, dass die Arbeitslosigkeit hoch bleiben wird und die Löhne nur langsam steigen werden – die Stundenlöhne übertrafen übrigens im zweiten Quartal ihren Vorjahreswert nur um 1,1 Prozent, so dass sich unter Berücksichtigung des Produktivitätsfortschritts ein Rückgang der sogenannten Lohnstückkosten von 0,6 Prozent ergab. Die Löhne wirken zur Zeit tendenziell deflationär.
Es dürfte die EZB wohl auch beunruhigen, dass sowohl M3 als auch die Kreditvergabe an den privaten Sektor für ihren Geschmack viel zu langsam expandieren (im Vorjahresvergleich mit 1,0 und 0,9 Prozent). Einst galten ja Zuwachsraten in der Größenordnung von 4 1/2 Prozent als ideal. Es wird durch den Ankauf von Staatsanleihen Geld gedruckt (oder besser: wurde gedruckt) und die Zuteilungen bei den Geldmarktgeschäften sind nach wie vor üppig, die Geldnachfrage aber springt nicht an. So gesehen haben wir es mit einem Charakteristikum einer Deflation zu tun. Der Wert des Geldmultiplikators scheint weiter zurückzugehen, die Märkte reagieren nicht richtig auf die Signale der Notenbank.
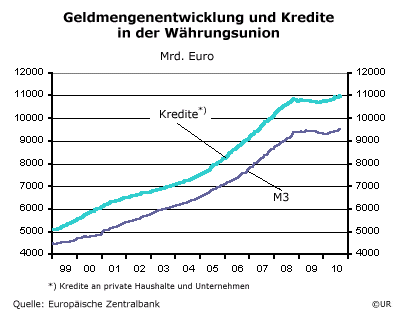
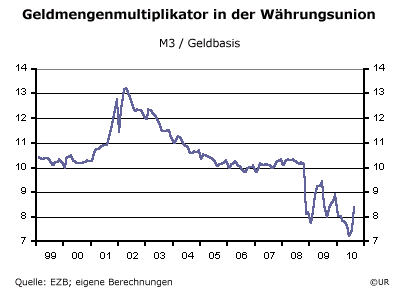
Das hat vielleicht doch damit zu tun, dass auch in der Währungsunion ein Prozess der Sanierung von Bilanzen im Gange ist, also ein Abbau von Schulden. Das betrifft vermutlich sowohl die Haushalte als auch die Unternehmen. Immerhin sah es schon schlimmer aus, und mit einigem guten Willen, oder einer Lupe, könnte ich erkennen, dass sich der Prozess seinem Ende nähert. Jetzt schon grünes Licht zu geben, wird die EZB aber nicht wagen.
Mit anderen Worten, einige wichtige Indikatoren sprechen gegen eine Deflation, andere aber raten zur Vorsicht. Da es mangels erprobter Instrumente für eine Zentralbank viel schwieriger ist, eine Deflation zu bekämpfen als eine Inflation, spricht alles dafür, dass die Geldpolitik ihren expansiven Kurs beibehalten wird.
Ein richtiges Deflationsproblem haben allerdings die USA. Die Zinsen sind bereits bei Null, die Finanzpolitik ist längst an ihr Limit gestoßen, die Beschäftigung liegt um etwa 5 Prozent unter ihrem letzten Höchststand, die Kerninflationsrate ist auf ihrem Weg nach unten im dritten Quartal bei einer annualisierten Rate von 0,8 Prozent angekommen, und mindestens ein Viertel aller Haushalte hat Hypothekenschulden, die den stark gesunkenen Wert ihrer Häuser übersteigen. Dabei sinken die Immobilienpreise weiter, nachdem sie sich für eine Weile erholt zu haben schienen. Wir können von Glück sagen, dass die Schwellenländer bislang keine Schwäche zeigen und das, was sich in Amerika zusammenbraut, einigermaßen wettmachen. Bislang geht es in den USA immer noch in Richtung japanische Verhältnisse, nur dass sein Anteil am globalen BIP etwa dreimal so groß ist wie der von Japan. Entsprechend groß ist das Risiko für die Weltwirtschaft – und für uns.