Manchmal wird mir doch etwas mulmig. Bisher hatte ich der Eurokrise ziemlich gelassen zugesehen, nach dem Motto, wir kommen in Europa nicht voran, wenn es nicht eine existenzielle Krise zu überwinden gilt – ohne Krise kein Fortschritt in Richtung politische Union und Demokratie und Wohlstand für alle Europäer. Daher fand ich es meistens toll, wenn es mal wieder eine Krise gab.
Nur sind die Summen, um die es jetzt gehen könnte, so gewaltig, dass ein Auseinanderbrechen des Eurosystems nicht mehr auszuschließen ist. Die potenziellen Gläubiger, vor allem Deutschland sowie Holland, Österreich und Finnland, auf die ein Drittel der Bevölkerung und ein etwas größerer Anteil am gemeinsamen BIP entfallen, könnten schon in Kürze an einen Punkt kommen, an dem die Rettungsprogramme politisch nicht mehr zu vermitteln sind. Was haben vor allem die Deutschen davon? In den sieben Landtagswahlen, die 2011 anstehen, wird zu erklären sein, warum es sich lohnt, weiterhin und in immer größerem Maße der Zahlmeister Eurolands zu sein. Das ist kein Thema für Populisten. Frau Merkel wird sich zu einer glühenden Verfechterin des europäischen Projekts wandeln müssen, wenn sie argumentativ die Oberhand behalten möchte. Hat die Bildzeitung eigentlich schon begonnen, sich auf das Thema „zurück zur D-Mark“ einzuschießen?
Der Euro ist inzwischen fast unbemerkt zu einer Schwachwährung geworden. Seine handelsgewogene Abwertung, wie sie täglich von der Bank of England berechnet wird, beträgt seit Oktober 2009 – dem letzten Hoch – 12,5 Prozent; in derselben Zeit hat sich die britische Währung um rund ein Prozent aufgewertet, und das trotz eines riesigen Leistungsbilanzdefizits und eines staatlichen Haushaltslochs, das in Relation zum BIP in diesem Jahr mit 13,5 Prozent mehr als doppelt so hoch sein dürfte wie das der Eurozone von voraussichtlich 6,5 Prozent. Das Vertrauen in den Euro ist offenbar hin, wenn ihm selbst das Pfund Sterling vorgezogen wird.
Nun ist sogar die Kreditwürdigkeit Frankreichs ins Gerede gekommen – ich sehe, dass die Kosten für die Ausfallversicherung („credit default swaps„) französischer Staatsanleihen auf ein Rekordniveau gestiegen sind: Mitte 2009 hatte es, fast so wie in Deutschland, 25.000 Euro pro Jahr gekostet, zehnjährige Anleihen im Nominalwert von 10 Mio. Euro gegen einen Zahlungsausfall zu versichern, heute sind es inzwischen 123.000 Euro. Dabei hat sich der Renditeabstand zu Bundesanleihen bereits auf 35 Basispunkte vergrößert – vor der Krise waren 10 bis 20 Basispunkten normal. Am Markt wird bereits spekuliert, dass die französischen Staatsschulden ihr Top-Rating verlieren könnten. Wenn auch Frankreich gerettet werden muss, können wir das Europrojekt ad acta legen. Schon mit Italien wären die Gläubiger überfordert.
Noch skeptischer sind die Märkte natürlich gegenüber den Ländern in der sogenannten Peripherie. Credit default Swaps kosten für Griechenland 877.000 Euro (11,80 Prozent) (Rendite für Zehnjährige in Klammern), für Irland 589.000 Euro (8,46 Prozent), für Portugal 427.000 Euro (6,29 Prozent), für Spanien 341.000 Euro (5,48 Prozent) und für Italien 218.000 Euro (4,61 Prozent). Im großen Ganzen frisst die Versicherung die Rendite mehr als auf und die Anleger kommen auf einen effektiven langfristigen Zins, der niedriger ist als die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von zur Zeit 2,97 Prozent.
Relativ am besten sieht es in Griechenland aus. Dort kostet übrigens, um einmal kurz abzuschweifen, die Anleihe, die im Juni 2010 fällig ist, nur noch 69,00 Euro (Kupon 6 1/4 Prozent, Nominalwert 100). Wenn der sogenannte Haircut eines Tages, nach einer Umschuldung, 30 Prozent betragen sollte, haben die Anleger, die zum heutigen Kurs kaufen, nichts verloren, derweil ihr sogenannter laufender Zins (6,25/69 =>) 9,06 Prozent beträgt, was ja nicht schlecht ist. (Ein „Haircut“ ist das Maß dafür, um wie viel die Verbindlichkeiten eines Landes bei einer Umschuldung zu Lasten der Anleger reduziert werden.)
Ein anderer Indikator für die Zunahme des Risikos ist der steile Anstieg der Renditen in den letzten Wochen. Das gilt auch für Deutschland: Seit August haben die Renditen der zehnjährigen „Bunds“ von 2,12 Prozent auf 2,97 Prozent zugelegt, und die Kosten der Kreditversicherung sind ebenfalls kräftig gestiegen, auf jetzt 76.000 Euro. Sie sind jetzt höher als die für US Treasuries.
Ich behaupte, dass der Zinsanstieg am langen Ende der Kurve weniger mit anziehenden Inflationserwartungen zu tun hat als vielmehr mit den Problemen staatlicher europäischer Schuldner in Verbindung mit den vermutlich noch größeren Problemen der Banken. In Irland und Spanien wurden ja bekanntlich nicht die Maastricht-Kriterien verletzt – beide Länder galten in dieser Hinsicht bis zuletzt als Musterknaben -, vielmehr waren die Regierungen gezwungen, ihren Bankensektor herauszuhauen. Dadurch kamen sie dann selbst ins Schleudern.
Sowohl die nationalen Notenbanken als auch die nationalen Aufsichtsbehörden als auch die EZB hatten nicht bemerkt, wie sich gewaltige kreditbefeuerte Immobilienblasen bildeten und wie sich dadurch die Qualität der Bankaktiva existenzbedrohend verschlechterte. Oder sie hatten es vermutlich gemerkt, in ihrer Marktgläubigkeit aber darauf gesetzt, dass es keine systemischen Krisen mehr geben könnte. Oder sie hatten einfach vergessen, wie gefährlich Vermögensblasen sind, und wie hilflos die Geldpolitik ist, wenn sie einmal geplatzt sind. Dabei hätten sie nur nach Japan schauen müssen – aber Japan wurde als irrelevanter Sonderfall abgetan: So dumm und lahm wie die japanischen Wirtschaftspolitiker würde man schon nicht sein.
Die Probleme der Schuldner aus der Peripherie des Eurolands betreffen natürlich nicht nur die Gläubiger aus dem Euroland, sondern die ganze Welt, so wie ja auch die Pleite von Lehman Brothers globale Schockwellen ausgelöst hatte. Wir haben es hier mit einem noch gewaltigeren Gefahrenpotenzial zu tun. Daher steigen die Renditen jetzt weltweit. Die Basler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), die als Zentralbank der Zentralbanken gilt, hat in ihrem jüngsten Quartalsbericht gezeigt, dass die Banken der Welt Ende Juni allein gegenüber den vier Ländern Griechenland, Irland, Portugal und Spanien Forderungen („foreign exposures„) von insgesamt 2281 Mrd. Dollar in ihren Büchern hatten. Bei Lehman ging es damals um etwa 600 Mrd. Dollar. Es fragt sich, wie es um die Qualität der Aktiva und die Zahlungsfähigkeit der Schuldner aus diesen Ländern bestellt ist. Der Markt jedenfalls ist zunehmend skeptisch. Wo ein Überangebot an Immobilien existiert, sind sowohl ein Preisverfall als auch eskalierende Bankenprobleme vorprogrammiert.
Die Anleger haben zur Zeit schlichtweg Angst, dass die Probleme Eurolands einen Dominoeffekt haben könnten. Sachwerte sind daher wieder gefragt, obwohl die nach wie vor niedrige Auslastung des globalen Produktionspotenzials und die hohe Arbeitslosigkeit eigentlich dafür sprechen, dass es keine ernsthaften Inflationsgefahren gibt. Wer sein Geld einigermaßen sicher anlegen wollte, hat in den vergangenen Monaten schwedische, mexikanische, kanadische, amerikanische, deutsche, japanische und australische Aktien gekauft und erst einmal die Gewinne mitgenommen, die seit Anfang der achtziger Jahre bei festverzinslichen Wertpapieren aufgelaufen sind. Damals hatte es den Wendepunkt bei den Bondrenditen gegeben – als es für zehnjährige Bundesanleihen kurzzeitig einmal 10,7 Prozent gab. Auch Rohstoffe sind als angeblich sichere Anlage zur Zeit sehr beliebt.
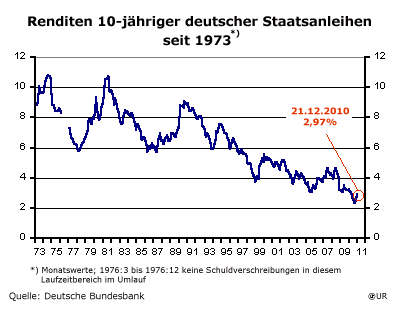
Ich glaube nicht daran, dass uns jetzt schon wieder jahrzehntelang steigende Inflationsraten und steigende langfristige Zinsen bevorstehen, ich kann die Sorgen der Anleger aber nachvollziehen. Sie beobachten ja zudem auch mit Grausen, wie vor allem in den USA die Nachwirkungen der geplatzten Immobilienblase dadurch bekämpft werden, dass durch den Ankauf von staatlichen und halbstaatlichen Anleihen immer mehr Geld gedruckt wird. Das erinnert fatal an die Geldpolitik nach dem Platzen der Dotcom-Blase im Frühjahr 2000, oder an einen Drogenabhängigen, der angeblich nur mit immer größeren Dosen an Heroin überleben kann. Hier werden neue Blasen aufgepustet. Bei Rohstoffen sieht es schon jetzt danach aus.
Was ist zu tun? Die Zeit drängt, und mutige Entscheidungen sind gefragt. Wenn der Euro erhalten werden soll, müssen belastbare Lösungen gefunden werden: Der Rettungsschirm muss drei- bis viermal größer sein als bisher, es sollte unvoreingenommen über gemeinsame Euroland-Anleihen und den Einstieg in eine eng koordinierte Finanzpolitik gesprochen werden. Alles muss auf den Tisch. Und es fehlt nicht an vernünftigen Vorschlägen. Da Deutschland der Hauptgläubiger ist, kann es Bedingungen stellen, beispielsweise, dass es kein Steuerdumping mehr geben kann (Irland, Luxemburg, Österreich), dass die Bankenaufsicht stark zentralisiert werden muss, dass die Geldpolitik auch dafür sorgen muss, dass keine neuen Assetblasen entstehen (sie braucht also ein breiteres Mandat), und dass die jetzigen Schuldnerländer gezwungen werden, ihre Haushaltsdefizite in einem überschaubaren Zeitraum auf das Niveau ihrer Investitionen zurückzufahren und dann dort zu belassen. Strikte Konditionalität ist dringend geboten.
Wenn es so laufen sollte, dann war es am Ende doch eine gute Krise.