Es sind erschreckende Zahlen, die die Frankfurter Rundschau heute auf den Markt geworfen hat: Nach ihren Recherchen war das Ergebnis der bisherigen Tarifverhandlungen 2011 unglaublich mickrig. „In den drei großen Branchen Bau, öffentlicher Dienst und Chemie erhalten die Beschäftigten in diesem Jahr gerade einmal 2 bis 2,6 Prozent mehr Geld als im Vorjahr“, heißt es in der Analyse. Abzüglich der Inflation bedeutet dies sogar einen Reallohnverlust. Die Arbeitnehmer werden ärmer und das trotz kräftigen Wachstums gepaart mit einer signifikant abnehmenden Arbeitslosigkeit. Damit verschärfen die deutschen Arbeitgeber und Gewerkschaften die Eurokrise. Denn einerseits kann die Binnennachfrage so kaum richtig anziehen und zum Abbau der Ungleichgewichte in Euroland beitragen. Andererseits fährt Deutschland damit weiter einen Kurs der Abwertung innerhalb der Währungsunion und konterkariert alle Anstrengungen von Griechenland, Spanien und Co. wieder Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen.
Wettbewerbsfähigkeit ist nämlich ein relatives Konzept, kein absolutes. Und solange die Löhne in Deutschland unterdurchschnittlich steigen, solange verbessert sich seine Wettbewerbsfähigkeit. Solange rückt das Land keinen Meter von seiner merkantilistischen Exportstrategie ab. Solange kann der Stress im Eurosystem nicht geringer werden. Damit es kein Vertun gibt: Die Ursache der Euro-Krise sind die Divergenzen in den Mitgliedsländern. Hier das Überschussland schlechthin, das alleine im März Waren im Wert von 15 Milliarden Euro mehr ausgeführt hat als eingeführt, dort die Defizitländer, die mehr verbrauchen als sie produzieren.
Was sind unterdurchschnittliche Lohnerhöhungen? Alle unter drei Prozent auf jeden Fall. Durchschnittliche Lohnsteigerungen ergeben sich aus der angestrebten Inflation der Europäischen Zentralbank von nahe zwei Prozent sowie dem langfristigen Produktivitätsfortschritt, der vorsichtig mit einem Prozent pro Jahr angesetzt wird. Diese drei Prozent geben auch den oft zitierten Verteilungsspielraum an. Werden sie erreicht, ändern sich Lohn- und Gewinnquoten in der Volkswirtschaft nicht. Werden sie unterschritten, steigt die inzwischen rekordhohe Gewinnquote nur noch weiter.
Die enormen Ungleichgewichte in Euroland resultieren daraus, dass Deutschland seit dem Jahr 2000 noch in keinem Jahr Lohnsteigerungen in Höhe von drei Prozent erreicht hat. Das hat die Lohnstückkosten nach unten getrieben und deutsche Produkte immer billiger gemacht. Werfen Sie einen Blick auf die Lohnstückkostenkurven, die in einer Währungsunion die Funktion des Wechselkurses übernehmen.
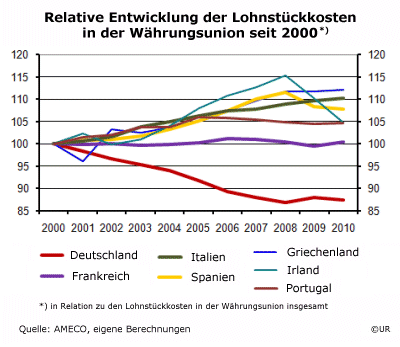
Sie sehen, wie drastisch Deutschland abgewertet hat – zum Nachteil der hiesigen Arbeitnehmer, deren Einkommen seit elf Jahren real stagnieren oder gar rückläufig sind, zum Nachteil des Euroraumes, der jetzt kurz vor dem Zerreißen steht. Dass es so kommen würde, dafür brauchte man kein Hellseher sein. Die Lohnstückkostenkurven haben dieses schon vor Jahren angezeigt. Lesen Sie diesen fünf Jahre alten Blog-Eintrag „Merkel, die Merkantilistin“. Damals, weit vor der Finanzkrise, schrieb ich: „Macht Deutschland so weiter wie in den vergangenen Jahren, bleibt nur zweierlei: Entweder Italien, Spanien und Frankreich verlassen die Währungsunion, werten ab und machen die Wettbewerbsvorteile der Deutschen auf einen Schlag zu Nichte. Oder sie verfolgen dieselbe Politik der Lohnzurückhaltung, gepaart mit wirtschaftspolitischen Annehmlichkeiten für die Unternehmen. Die Folgen wären ein auf Jahre hinweg schwaches Wachstum in Euroland und deflationärer Druck.“
Kurzum: Ich ertrage die heuchlerische wirtschaftspolitische Debatte in Deutschland kaum. Schuld sind nicht nur die Griechen, die schludern, die Spanier, die ihren Immobilienmarkt haben heiß laufen lassen, die Iren, die ihre Banken nicht richtig beaufsichtigt haben. Schuld an der Euro-Krise haben auch und vor allem die Deutschen. Sie spielen seit mindestens sechs Jahren Foul, sie sind Trittbrettfahrer auf der Nachfrage der anderen Länder, sie exportieren in hohem Maße Arbeitslosigkeit. Spätestens 2005 war die Wettbewerbsfähigkeit wieder hergestellt, hätten die Löhne wieder mit drei Prozent steigen müssen. Dass sie es selbst im Superjahr 2011 nicht tun, heißt nichts Gutes für den Fortbestand der Währungsunion.