Wie schnell sich die Dinge ändern: Vor ein paar Tagen sah es noch ganz danach aus, als erwäge die EZB ernsthaft, die Zinsen zu erhöhen. Die Lage bei den Auftragseingängen sah hervorragend aus, ebenso bei der Industrieproduktion, der Ifo-Geschäftsklimaindex war einige Monate in Folge wieder geklettert, die Beschäftigung im Euroraum lag um anderthalb Prozent über dem Vorjahreswert, die Arbeitslosenquote war auf 7,2 Prozent gefallen, den niedrigsten Wert seit Beginn der Währungsunion, die Geldmenge M3 schien völlig außer Kontrolle geraten zu sein, jedenfalls aus Sicht der EZB, und vor allem war die Inflation bei den Verbraucherpreisen im März auf 3,6 Prozent geklettert. Der starke Euro hatte bislang keine Spuren im Außenhandel hinterlassen.
Zudem hatte der IWF erneut prognostiziert, dass sich das Wachstum des globalen BIP in diesem und im nächsten Jahr nur ein bisschen abschwächen würde, jedenfalls nicht annähernd so stark wie zu Beginn des Jahrzehnts, als es zum letzten Mal zu einer Wachstumsdelle gekommen war. Da die Weltwirtschaft sich damit im Grunde weiterhin in einem Zustand der Hochkonjunktur befindet, dürften die Rohstoffpreise daher hoch bleiben, so dass die Inflationsaussichten von dieser Seite her nach wie vor schlecht waren. Was den Euroraum betraf, bestand, oder besteht, zwar Konsens darüber, dass sich das Wachstum in diesem Jahr verlangsamen würde, aber insgesamt schien sich realwirtschaftlich alles moderat und einigermaßen im Gleichgewicht zu entwickeln, wie es sich für den alten Kontinent gehört. Das einzig Irritierende war die Inflation. Wenig sprach jedenfalls dafür, dass die EZB die Zinsen senken sollte, was wiederum der Grund für die Aufwertung des Euro war – die Fed befand sich demgegenüber auf Expansionskurs.
Das Bild hat sich in den letzten Tagen nun doch ziemlich eingetrübt, so wie es angesichts des starken Anstiegs der Einfuhrpreise in den letzten Monaten und des festen Euro eigentlich schon längst fällig gewesen wäre.
Wir erleben gerade einen massiven Verlust an Kaufkraft. Die Kommentatoren regen sich darüber auf, dass die deutschen Renten in diesem Sommer statt um 0,5 Prozent um nicht weniger als 1,1 Prozent steigen werden. Real sinken sie aber um rund 2 Prozent. Im Euroraum gehen die Löhne neuerdings real ebenfalls zurück. Das reflektiert die Schwäche im Kampf um die Anteile am globalen Output, in dem sich Euroland zur Zeit gegenüber den Rohstoffexporteuren auf der Verliererseite befindet. Gäbe es nicht den festen Euro, wäre die Lage natürlich noch viel schlimmer. Die USA müssen ohne einen solchen Puffer auskommen – dort liegen die Einfuhrpreise um 13,4 Prozent über ihrem Vorjahresniveau.
Inzwischen ist nicht mehr zu leugnen, dass die jetzige Ölkrise ähnlich ernst ist wie die zu Beginn der achtziger Jahre. Wenn der Ölpreis nicht in Kürze deutlich fällt, ist es schwer vorstellbar, wie der private Konsum in Fahrt kommen soll. Vom Wechselkurs her gewinnen die Haushalte zwar tendenziell an Kaufkraft, die Explosion der Preise für Energie und Nahrungsmittel führt aber leider dazu, dass es unterm Strich zu einem Verlust kommt. Nicht zu vergessen im Übrigen, dass es ja seit einiger Zeit auch beträchtliche negative Vermögenseffekte in den Ländern des Euroraums gibt, in denen die Konjunktur lange von steigenden Immobilienpreisen stimuliert worden war. Das gilt insbesondere für Spanien und Irland, etwas weniger auch für Italien und Frankreich. Vom Konsum in diesem Jahr viel zu erhoffen ist reines Wunschdenken.
Der „überteuerte Euro“, wie das gestern Nikolaus Piper in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat, „schadet der europäischen Exportwirtschaft. … der Druck auf alle Firmen, die in den Dollarraum exportieren, nimmt zu, je länger die Währungsspekulation dauert.“ Das ist richtig, wird dem Ernst der Lage aber nicht gerecht. Denn erstens leiden auch solche deutschen und europäischen Anbieter unter dem schwachen Dollar, die nicht exportieren (weil sich der Wettbewerb mit den Amerikanern im Inland ebenfalls verschärft), sondern es haben zweitens selbst diejenigen Exporteure größere Schwierigkeiten, die nicht in den Dollarraum exportieren, etwa nach Japan oder nach Großbritannien – die amerikanischen Unternehmen sind einfach überall vom Preis her im Vorteil. Es regt mich auf, dass in der Presse immer nur die Unternehmen, die in den Dollarraum exportieren, als Leidtragende gelten.
Und des weiteren: Haben wir es wirklich nur mit einer Währungsspekulation zu tun? Der Dollar ist schwach, weil es zu viel davon gibt, und weil die Erträge aus Dollaranlagen wegen der US-Rezession (bei Aktien und Immobilien) und der expansiven Geldpolitik (bei Anleihen und Geldmarktpapieren) zur Zeit nicht attraktiv sind. Die Abwertung des Dollars war überfällig, weil das reichste und größte Land nicht auf Dauer der größte Nettokapitalimporteur bleiben konnte – in anderen Regionen der Welt kann man mit seinem Kapital schließlich mindestens so hohe Erträge erzielen wie in den USA, vor allem in den Schwellenländern Asiens und Osteuropas. Die Anleger haben immer weniger Lust, ihr „concentration risk“, wie das Allan Greenspan mal genannt hat, weiter zu erhöhen, also alle Eier in den amerikanischen Korb zu stecken. Wenn es nur um Währungsspekulation ginge, könnte man schon bald eine Umkehr des Wechselkurses erwarten. Es geht aber um mehr, nämlich um den Abbau des zentralen weltwirtschaftlichen Ungleichgewichts. Eine neue Struktur der relativen Preise, die das bewirkt, lässt sich am leichtesten über die Wechselkurse erreichen. Das hat wenig mit Spekulation, aber viel mit Marktwirtschaft zu tun, der Deflation einer Blase.
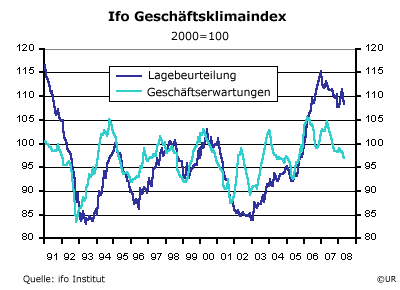
Ich vermute, dass der starke Rückgang des Ifo-Index in diesem Monat durch die anhaltende Konsumschwäche im Inland und den scharfen Gegenwind auf den Devisenmärkten zu erklären ist. Auch der außerordentlich geringe Anstieg der Geldmenge M1 im März (2,9 Prozent ggVj) ist für mich ein Indiz, dass die europäische Nachfrage in den kommenden Monaten schwächer ausfallen wird. Der Rückgang der Zuwachsrate von M3 von 11,3 Prozent im Februar auf 10,3 Prozent im März weist in dieselbe Richtung, ebenso wie die schwache Kreditvergabe an die Haushalte (5,4 Prozent ggVj). Offenbar bricht die Nachfrage nach Hypotheken gerade weg. Es verblüfft nur auf den ersten Blick, dass gleichzeitig die Kredite an Unternehmen außerhalb des Finanzsektors trotz höherer Geldmarktsätze, gestiegener Bonitätsanforderungen und ungünstigerer Konjunkturaussichten immer stärker expandieren: Da der Markt für Unternehmensanleihen zur Zeit wenig aufnahmefähig ist, gewinnen die traditionellen Bankkredite an Bedeutung. Die monetären Indikatoren dürften, was den Inflationsdruck angeht, auf die EZB erstmal beruhigend wirken. Ebenso die deutschen Einfuhrpreise, die im März gegenüber dem Vormonat trotz des neuen Ölpreisschubs saisonbereinigt nicht mehr gestiegen sind.
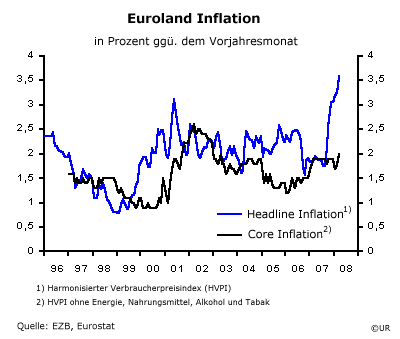
Insgesamt ist es erst einmal unwahrscheinlicher geworden, dass die EZB tatsächlich die Zinsen erhöhen wird. Weil die Märkte das auch so sehen – und die Fed nach der nächsten Senkung wohl eine Pause einlegen wird – hat sich der Euro heute stark abgeschwächt. Importierte Rohstoffinflation lässt sich ohnehin nicht mit einer restriktiven Geldpolitik bekämpfen, oder nur um den Preis einer Rezession. Wir sollten besser die Steuern auf den Energieverbrauch erhöhen, die übrigen indirekten Steuern aufkommensneutral senken und die ungerechtfertigte Bevorzugung von Diesel und Kerosin beenden. Let’s raise the taxes on oil, and we’ll dance on OPEC’s grave, hat mal ein kluger Mann gesagt – fragen Sie mich aber bitte nicht, wer das war.