Der Unterschied zu den USA ist frappierend: Dort hat das Wachstum im zweiten Quartal Fahrt aufgenommen, um ein Prozent stieg die Wirtschaftsleistung gegenüber dem Vorquartal und die Anzahl der neuen Jobs nimmt mit einer Jahresrate von fast zwei Prozent zu. Im Euroland dagegen stagniert das reale BIP nach zwei Jahren Rezession schon wieder; am Arbeitsmarkt hat sich die Lage bisher kaum gebessert und ist daher nach wie vor katastrophal. Woher kommt‘s?
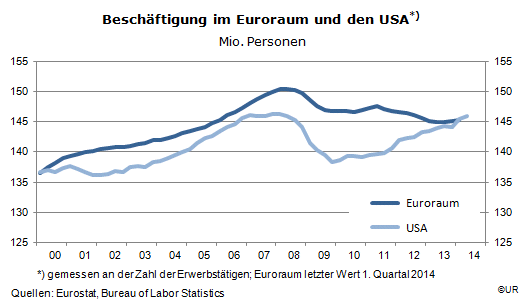
Die Frage ist natürlich leichter gestellt als beantwortet. Um mit der Geldpolitik zu beginnen, an den Leitzinsen dürfte es nicht gelegen haben, die sind in beiden Wirtschaftsräumen seit langem in der Nähe von Null. Real; also unter Berücksichtigung der Inflationsrate, ist die Fed Funds Rate allerdings inzwischen stark negativ, während der Hauptrefinanzierungssatz der EZB nur gerade mal so ein bisschen in den roten Bereich gerutscht ist. Mit den aktuellen Inflationsraten der Verbraucherpreise gerechnet ergibt sich für die USA ein Wert von -2,01 Prozent und für die Währungsunion ein Wert von -0,35 Prozent; auf der Basis der mittelfristig erwarteten Inflationsraten ist die Diskrepanz ähnlich groß: USA -1,79 Prozent, Euroland -0,22 Prozent. Mit anderen Worten, die US-Geldpolitik ist gemessen an den realen Leitzinsen expansiver als die europäische – vor allem wegen der höheren Inflationsraten und Inflationserwartungen. Vermutlich kann die EZB kurzfristig daran kaum etwas ändern, so gern sie das möchte. Angesichts der viel niedrigeren Kapazitätsauslastung und der hohen Arbeitslosigkeit lässt sich die Inflation nicht mal eben so beschleunigen. Noch geht es eher in Richtung Deflation.
Gemessen daran, wie stark das Volumen an Zentralbankgeld zunimmt, ist und war die amerikanische Geldpolitik ebenfalls viel expansiver als die europäische. Obwohl die monatlichen Nettokäufe von Staatsanleihen und Bonds der großen Hypothekenbanken, Fannie Mae und Freddie Mac, von einst 85 Mrd. Dollar auf voraussichtlich Null im kommenden Oktober zurückgefahren werden, hat sich die Bilanzsumme des US-Notenbanksystems in den vergangenen fünf Jahren um 120 Prozent erhöht; gegenüber dem Sommer 2007, also der Zeit vor Ausbruch der Finanzkrise, waren es 390 Prozent. Die vergleichbaren Zahlen für das Eurosystem sind 10 und 70 Prozent.
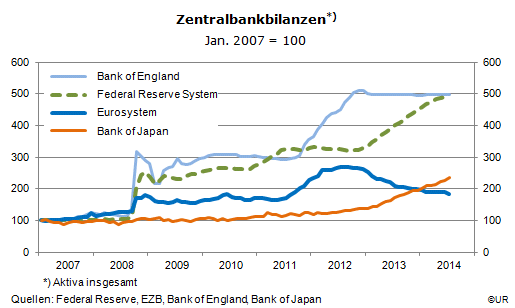
Seit zwei Jahren schrumpft die Bilanzsumme der EZB. Die Banken brauchen weniger Geld von der Zentralbank als sie ihnen anbietet. Der niedrige Zins, zu dem sie sich verschulden können, ist natürlich attraktiv, aber er ist nicht alles, wenn es darum geht, Kredite an die Privatwirtschaft und den Staat zu vergeben. Die Nachfrage ist einfach zu schwach. Billiges Geld ist da, doch es gibt zu wenige Abnehmer, an die es sich verleihen ließe, ohne dass die Qualität des Kreditportefeuilles darunter leidet. Warum ist das so?
Seit dem Beginn der Währungsunion im Januar 1999 hat sich die Verschuldung des privaten (nicht-finanziellen) Sektors stark erhöht, vor allem im Zeitraum 2004 bis 2008. Nicht nur in absoluten Zahlen, sondern auch in Relation zum nominalen BIP kam es zu einem starken Anstieg der Schulden, der ein Spiegelbild der guten Konjunktur jener Jahre war. Noch nie seit Menschengedenken waren die Realzinsen so niedrig – die Risikoprämien, die in den Jahrzehnten zuvor in den Weichwährungsländern der Peripherie zu zahlen waren, entfielen auf einmal durch die Mitgliedschaft in einem Hartwährungsblock. Zudem war das Niveau der Einkommen so niedrig, dass selbst hohe Lohnsteigerungen zunächst die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu beeinträchtigen schienen. Die Lohninflation und die gute Stimmung am Arbeitsmarkt wiederum stimulierten die Kreditaufnahme, und die Banken zogen gerne mit.
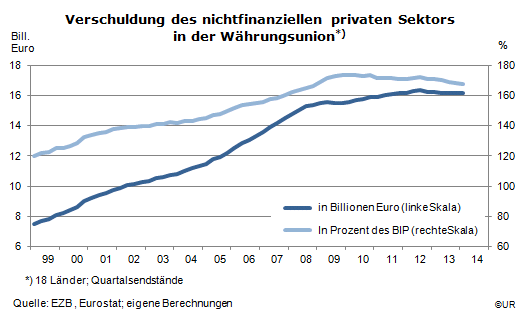
Eine steigende Verschuldung ist an sich nichts Schlimmes, denn des Einen Schulden sind des Anderen Forderungen und damit eine Komponente des Vermögens. In allen wachsenden Ländern nimmt der Anteil der Schulden und des Finanzvermögens am BIP ständig zu. Es ist ein Megatrend, der mit der immer intensiveren Arbeitsteilung einhergeht. Die Sache wird nur dann riskant und letztlich nicht mehr haltbar, wenn die Schulden für Konsumgüter oder Immobilien aufgenommen werden, die nicht genug oder sogar gar keinen Ertrag abwerfen, beispielsweise weil es ab einem bestimmten Punkt zu einem Überangebot an Immobilien kommt und dann sowohl die Mieten als auch die Preise der Objekte in den Keller gehen. Die Regel, wonach man sich nur für etwas Geld leihen sollte, was sich rentiert und den Schuldendienst ermöglicht, wurde in großem Stil verletzt. Die Banken, von keiner Aufsicht und keinen internen Kreditabteilungen wirkungsvoll gebremst, hatten sich an dem Spiel beteiligt. Sie verloren ihr Gefühl dafür, wie groß die Risiken ihrer Immobilienanlagen und Asset Backed Securities in Wirklichkeit waren.
Als die Blasen platzten, gab es viele Verlierer. Sie hatten sich finanziell übernommen und sind seitdem gezwungen, ihre Bilanzen zu bereinigen, und das heißt immer noch, die Gürtel enger zu schnallen und vor allem keine neuen Schulden aufzunehmen. Das gilt für Banken (die sich zudem mit dem Asset Quality Review der EZB herumschlagen müssen) und für eine Vielzahl von Haushalten in den Ländern der europäischen Peripherie, weniger dagegen für die nichtfinanziellen Unternehmen, die im Allgemeinen bilanzmäßig gut aufgestellt sind.
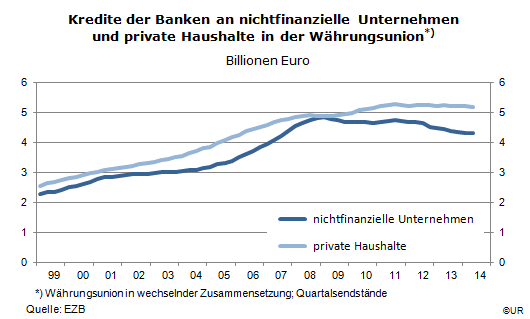
Anders als in den USA ist das sogenannte Deleveraging, der Abbau von Schulden, bei den europäischen Verbrauchern auf’s Ganze gesehen noch nicht vorangekommen. Auch angesichts der traurigen Situation am Arbeitsmarkt fühlen sie sich nicht gerade in der Stimmung, neue Schulden zu machen. Wie es aussieht, wird es noch einige Jahre dauern, bis sie ihre Kreditwürdigkeit wieder hergestellt haben und sich trauen, sich erneut mehr Geld zu leihen als in den vergangenen Jahren. Wie Reinhart & Rogoff in ihrem Buch This time is different zeigen, ziehen sich Finanzrezessionen wegen solcher Bilanzreparaturen lange hin.
Das beantwortet immer noch nicht die Frage, warum es in den USA mit dem Deleveraging so viel schneller ging als im Euroraum. Ein Grund war, wie erwähnt, vermutlich die entschlossenere Expansionspolitik der Notenbank, ein anderer die raschere Abwicklung notleidender Banken. Die USA verfügen über den unschätzbaren Vorteil, dass sie sowohl eine Bankenunion als auch ein gemeinsames zentrales Finanzministerium haben. Im Euroland sind wir noch weit davon entfernt, was es hierzulande in Krisenzeiten nicht gerade leicht macht, wirtschaftspolitisch angemessen zu reagieren. Amerika, Du hast es besser. Vielleicht sollten wir Europäer einmal darüber nachdenken, wie sich die Entschuldung von Haushalten nach US-Vorbild beschleunigen lässt. Damit die Konjunktur nach einer Krise wieder in Schwung kommt, sollten tendenziell die Schuldner besser gestellt werden als die Gläubiger – aber das ist ein weites Feld.
Die amerikanische Finanzpolitik war zudem während und unmittelbar nach der Rezession sehr expansiv und kümmerte sich nur wenig um die langfristigen Folgen der staatlichen Schuldenexplosion. Das kam später, ab 2011. Inzwischen ist die Budgetpolitik auf der Nachfrageseite der wichtigste Bremsfaktor für die Konjunktur. Was nur Wenigen bewusst ist: die Relation „Schulden zu BIP“ ist von 62,1 Prozent im Jahr 2007 auf voraussichtlich 106 Prozent in diesem Jahr gestiegen – in Euroland kam es „nur“ zu einem Anstieg von 66,4 auf 96 Prozent. Wenn die Krisenresistenz Eurolands verbessert werden soll, braucht es einen schlagkräftige zentralen Akteur in der Finanzpolitik, zumindest aber eine Stelle, die die Finanzpolitik koordinieren kann. Die Maastricht-Regeln sind sowohl zu lax als auch zu ehrgeizig, jedenfalls sind sie nicht mehr als eine Zwischenetappe auf dem Weg zu einer echten Fiskalunion.
Insgesamt ist nach meinem Eindruck der wichtigste Grund für die enttäuschend langsame Erholung der Konjunktur Eurolands, dass die Wirtschafts- und Währungsunion noch unvollendet ist. Institutionelle Nachteile lassen sich nicht rasch beheben. Auf Dauer müssen sie aber beseitigt werden, wenn der Euro überleben soll. Der Euro ist mehr als ein Festkurssystem und braucht daher mehr Elemente eines Nationalstaats.