Zu Beginn der Finanzkrise, im Jahr 2008, war das Bruttoinlandsprodukt der Währungsunion nur vier Prozent niedriger als das der USA – in diesem Jahr dürfte der Abstand 38 Prozent betragen. Anders ausgedrückt sind die Einkommen Eurolands, vor allem also die Löhne, relativ zu denen der USA, stark gesunken. Das ist in erster Linie die Folge der Abwertung des Euro und damit ein (gewünschter) Nebeneffekt der europäischen Geldpolitik, die inzwischen um Einiges expansiver ist als die amerikanische. Eine schwache Währung stimuliert in der Regel die Konjunktur und führt zudem über steigende Außenhandelspreise zu höheren Inflationsraten oder bremst das Abgleiten in die Deflation. EZB-Chef Draghi betont darüber hinaus immer wieder, dass es so lange bei der Politik des leichten Geldes bleiben wird, bis die Inflation dort ist, wo er sie haben will. Die EZB gibt Gas, die Fed hat begonnen zu bremsen. Darüber ist Euroland ein Billiganbieter geworden. Der Euro hat ja nicht nur gegenüber dem Dollar deutlich an Wert verloren, sondern auch gegenüber den Währungen der Handelspartner insgesamt.
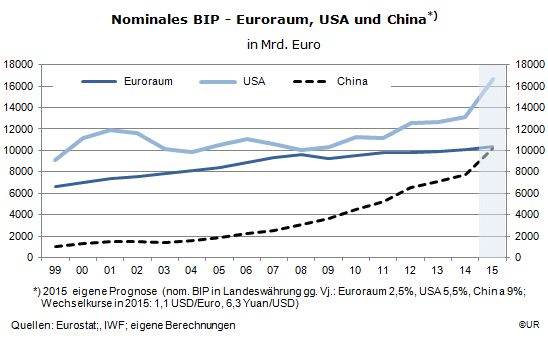
Bislang hat der schwache Euro noch nicht zu höheren Inflationsraten geführt. Wegen des Einbruchs der Rohstoffpreise, insbesondere des Ölpreises, müssen zurzeit trotz der Abwertung im Durchschnitt rund vier Prozent weniger für Einfuhren bezahlt werden als vor einem Jahr. Ohne die Abwertung lägen die Importpreise heute aber vermutlich um mindestens zehn Prozent unter ihren Vorjahreswerten und hätten entscheidend dazu beigetragen, die Inflationserwartungen zu reduzieren und das Deflationsrisiko zu erhöhen, also die deflationären Effekte, die von der hohen Arbeitslosigkeit und der immer noch gewaltigen Outputlücke ausgehen, zu verstärken.
So weit, so gut. Wenn der Euro allerdings auf Dauer eine Weichwährung bleiben sollte, reduziert das die Zuwachsraten der realen Einfuhren und stimuliert die Nachfrage des Auslands nach europäischen Gütern und Dienstleistungen, sodass der sogenannte Außenbeitrag eine zunehmend wichtige Rolle für die Konjunktur spielen wird – was nicht so schön wäre. Denn schon heute beläuft sich der Überschuss in der Leistungsbilanz auf etwa 250 Milliarden Euro pro Jahr oder 2,4 Prozent des Sozialprodukts, sodass Euroland immer mehr in eine Gläubigerposition gegenüber dem Rest der Welt gerät. Die USA machen es genau andersherum – sie sind bei Weitem der größte Schuldner. Bekanntlich haben die Schuldner die Gläubiger in der Hand, wenn die Beträge, um die es geht, nur groß genug sind. Einst war eine ausgeglichene Leistungsbilanz ein wünschenswerter Zustand und neben Vollbeschäftigung und niedrigen Inflationsraten ein gleichrangiges wirtschaftspolitisches Ziel.
Ob das auch heute so sein sollte, ist mir nicht ganz klar. Wenn ich mir die Liste der reichsten Länder ansehe, gemessen am BIP pro Kopf, stelle ich fest, dass sie allesamt, bis auf die USA und Großbritannien, beträchtliche außenwirtschaftliche Überschüsse aufweisen: Österreich, Deutschland, die Niederlande, Dänemark, Schweden, die Schweiz, Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand, Taiwan und Israel. Die Ölexporteure zählen in diesem Zusammenhang nicht. Offenbar ist es gar nicht so schlecht für den Lebensstandard eines Landes, wenn es Überschüsse gegenüber dem Ausland erwirtschaftet, also netto Kapital exportiert.
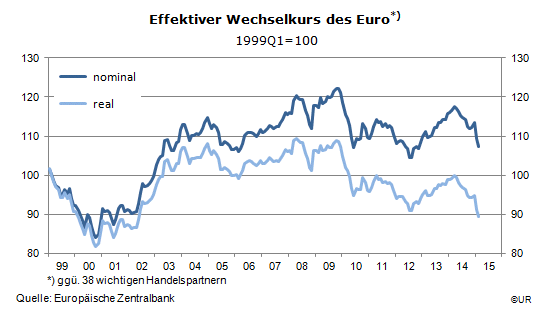
Schon beim jetzigen Niveau des Euro-Wechselkurses ist mit einem weiteren starken Anstieg des Außenbeitrags zu rechnen. Laut Umfragen unter professionellen Portfolio-Managern rechnen die meisten sogar damit, dass der Euro bis Jahresende mindestens bis auf die Parität zum Dollar fallen wird, also auf Eins zu Eins, oder darunter. Es sieht so aus, als ob sich die Spekulanten mehrheitlich gegen den Euro positioniert hätten. Sollten sie Recht behalten, würde der Überschuss in der europäischen Leistungsbilanz noch einmal stark zunehmen.
Ich glaube aber nicht, dass es mit dem Euro immer nur abwärts gehen wird. Schon die Tatsache, dass alle so negativ eingestellt sind, spricht dagegen. Irgendwann wird es angesichts dieser einseitigen Positionen bei den Marktteilnehmern Versuche geben, Gewinne mitzunehmen, also die Euros zurückzukaufen – bevor es die Anderen tun. Dann kann es beim Wechselkurs schnell einmal in die andere Richtung gehen. Vermutlich haben wir es bei der Euroschwäche mit einem vorübergehenden Phänomen zu tun. Fundamental ist der Euro unterbewertet.
Andererseits: Gewinnmitnahmen könnten den Euro auch schwächen, dann nämlich, wenn sich die Anleger eines Tages in großem Stil von ihren astronomisch teuren europäischen Bonds und den kaum weniger überbewerteten Aktien trennen sollten. Da aber die Märkte der USA, Großbritanniens, der Schweiz und Japans ebenfalls luftige Höhen erreicht haben, fragt sich, warum sie sich gerade von europäischen Werten trennen sollten, zumal der Euro so stark gefallen ist, dass er schon wieder Aufwertungspotenzial hat. Wir dürften es hier eher mit einem prekären Gleichgewicht als mit einer Zeitbombe zu tun zu haben. Weltweit könnten die Kapitalmärkte zwar irgendwann einbrechen – etwa wenn es in Schwellenländern mit hohen Dollarschulden zu Zahlungsproblemen kommt –, der Wechselkurs des Euro wäre davon aber nicht zwingend negativ betroffen.
Allerdings wäre eine weitere Abwertung aus europäischer Sicht nicht tragisch, denn noch hat der Kampf gegen die Deflation Priorität. Von daher kann der Euro gar nicht schwach genug sein – je schwächer, desto mehr Inflation wird importiert. Vor allem die USA würden dann aber ein Problem bekommen: Die Dollarstärke vermindert die internationale Wettbewerbsfähigkeit der amerikanischen Unternehmen, treibt den Außenbeitrag noch tiefer in die roten Zahlen und bremst so die Konjunktur. Der feste Dollar wirkt wie eine Zinserhöhung, oder eine Erhöhung der relativen Löhne. Ms. Yellen wouldn’t be amused.
Bisher hat der schwache Wechselkurs die europäische Konjunktur nur moderat befeuert, aber immerhin sind die realwirtschaftlichen Daten – BIP, Industrieproduktion, Beschäftigung, Umfragen bei Unternehmen –, die in den vergangenen Wochen hereinkamen, durchweg besser als erwartet, während sich das Deflationsrisiko zu vermindern scheint. Ich hatte im vergangenen Jahr zeitweise geglaubt, dass das reale BIP Eurolands 2015 um mehr als zwei Prozent gegenüber 2014 zulegen würde, was damals ziemlich übertrieben schien; mittlerweile nähern sich jedoch die Prognosen anderer Analysten diesem Wert. Vor allem der private Konsum legt zu, weil die Löhne stärker zunehmen als die Preise – und auch die Beschäftigung endlich wieder steigt (+0,4 Prozent gegenüber Vorjahr, was allerdings vor allem der guten Lage am deutschen Arbeitsmarkt geschuldet ist). Der Ifo-Indikator stieg im März erneut an, wie wir gestern erfahren haben, und hat ein Niveau erreicht, das beim realen BIP Deutschlands mit Wachstumsraten von mehr als zwei Prozent vereinbar ist. Spanische, französische, portugiesische und selbst italienische Prognosen werden zurzeit durchweg nach oben angepasst.
Die Konjunktur Eurolands profitiert zudem weiterhin von den niedrigen Leitzinsen, dem Kaufkraftgewinn durch die rückläufigen Ölpreise und einer insgesamt moderateren Finanzpolitik, sodass die Konsensprognose für das reale BIP dieses Jahres bei 1,5 Prozent angelangt ist, Tendenz steigend. Der große Durchbruch lässt aber weiter auf sich warten.
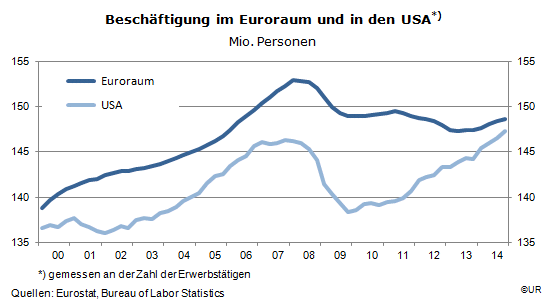
Vor allem am Arbeitsmarkt ist die Lage auch nach den jüngsten Erfolgsmeldungen nach wie vor katastrophal: Die Anzahl der Beschäftigten ist immer noch um rund fünf Millionen niedriger als vor der Finanzkrise und sogar um fast 15 Millionen niedriger als der Trendwert, der sich aus den Entwicklungen vor der Krise ergibt. In den USA läuft es in dieser Hinsicht bisher viel besser – dass die Fed darüber nachdenkt, ab September die Leitzinsen zu erhöhen, hat vor allem damit zu tun, dass die Beschäftigung seit Jahren mit Raten von etwa zwei Prozent steigt und die Arbeitslosenquote von 10,0 Prozent im Oktober 2009 auf 5,5 Prozent im vergangenen Monat gefallen ist. Im Euroland ist die Quote dagegen weiterhin zweistellig (11,2 Prozent im Januar), und sie sinkt nur im Schneckentempo. Sie hatte im Mai 2013 ihren Höchstwert von 12,1 Prozent erreicht. In den vergangenen zwei Jahren hat es also kaum Fortschritte gegeben.
Ich frage mich, warum die Abwertung des Euro und die dadurch signifikant verbesserte internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht stärker auf den Arbeitsmarkt durchschlägt. Vielleicht haben wir es hier mit längeren time lags zu tun, sodass die Haupteffekte noch gar nicht sichtbar sein können. Inzwischen ist der Euro aber bereits etwa 15 Monate im Rückwärtsgang, ohne dass die Beschäftigung bisher auf dieses mehr als deutliche Preissignal reagiert hat. Wenn sich hier nicht bald etwas tut, werden wir nicht um die Feststellung herumkommen, dass sich mit geld- und währungspolitischen Maßnahmen nicht mehr viel ausrichten lässt. Dann wäre die europäische Arbeitslosigkeit vor allem ein strukturelles Problem. Ich kann mich damit nicht anfreunden. In der Vergangenheit hat sich nämlich gezeigt, dass die „strukturelle Arbeitslosigkeit“ in Wirklichkeit rasch verschwindet, wenn die Konjunktur nur robust genug ist, wenn es also Wachstum gibt. Zuletzt war das in den USA zu beobachten. Warten wir noch ein paar Monate ab und hoffen in der Zwischenzeit, dass sich der Euro nicht zu rasch erholt.