Die Frage ist, warum in Deutschland nicht schon längst Hochkonjunktur herrscht. Im zweiten Quartal betrug die Zuwachsrate des realen BIP gegenüber dem ersten Quartal gerade einmal 0,4 Prozent, nach 0,3 Prozent im vorangegangenen Quartal. Das ist mehr als mickrig. Selten, wenn überhaupt jemals, war die Ausgangslage so günstig: der Wechselkurs ist sehr schwach, die Leitzinsen befinden sich real und nominal in der Nähe von Null, durch den Einbruch der Energiepreise hat es seit Mitte 2014 unerwartete Kaufkraftgewinne gegeben, und bei der Bautätigkeit und den Ausrüstungsinvestitionen gibt es einen beträchtlichen Nachholbedarf. Das alles vor dem Hintergrund eines robusten Arbeitsmarkts, einer gewaltigen Einwanderungswelle und Reallohnsteigerungen von 3 bis 3,5 Prozent.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Aber damit die Wirtschaft wirklich in Schwung kommt, muss der deutsche Staat aufhören, seine Haushaltsüberschüsse immer noch weiter zu steigern und so die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu bremsen. Im ersten Halbjahr übertrafen seine Einnahmen die Ausgaben um 21 Milliarden Euro, was bezogen auf das nominale BIP 1,4 Prozent ausmachte. Was soll das? Wovor haben die Wirtschaftspolitiker Angst, wofür sparen sie? Nach den Maastricht-Kriterien sind der öffentlichen Hand Defizite von bis zu drei Prozent des BIP erlaubt. Stattdessen diese ständig steigenden Überschüsse! Wir reden hier über ein verschenktes Wachstumsprogramm von mindestens 120 Milliarden Euro pro Jahr.
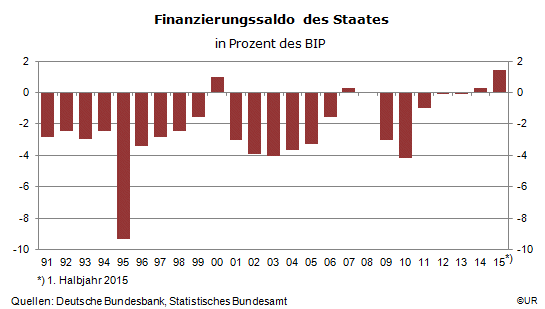
Überschüsse sind angebracht, wenn Vollbeschäftigung herrscht und die Löhne so stark steigen, dass sie die Inflationsrate der Verbraucherpreise auf deutlich über zwei Prozent zu treiben drohen. Die Wirtschaft ist aber weit von einer normalen, geschweige denn übermäßigen Auslastung der Kapazitäten entfernt, so dass es den Unternehmen nicht leicht fällt, ihre Preise zu erhöhen. Außerdem besteht ihre Priorität immer noch darin, mehr zu produzieren, auf diese Weise die Gemeinkosten pro Stück zu senken und so ihre Gewinne zu steigern. Erst wenn die Marktanteile gesichert sind, werden sie darüber nachdenken, ob sie ihre Outputpreise anheben sollten.
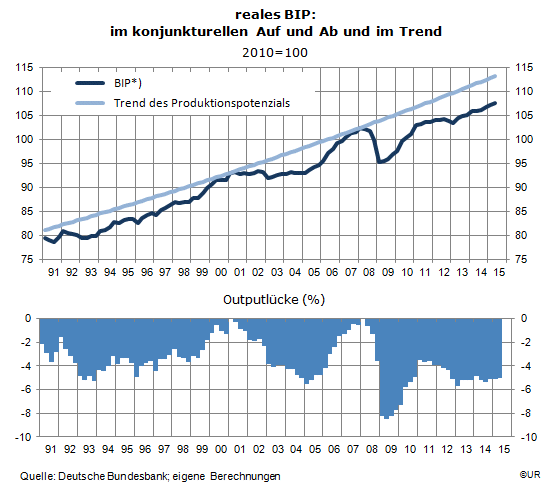
Der Staat hat die Pflicht, nicht zuletzt angesichts der prekären wirtschaftlichen Lage in den meisten anderen Ländern des Euroraums, die Nachfrage zu stabilisieren. Deutschland als der größte Gläubiger muss dafür sorgen, dass die Schuldner in die Lage versetzt werden, ihre Schulden zu bedienen. Das geht am besten, wenn sie im Ausland mehr verkaufen können. Nur mit ihren Exporteinnahmen können die Krisenländer der Schuldenfalle, in der sie stecken, entkommen. Mit anderen Worten, Deutschland muss aus Eigeninteresse mehr importieren, was wiederum bedeutet, dass die Konjunktur gut laufen muss. Da sie das nicht tut, sollte sie kräftig durch erhöhte Ausgaben und niedrigere Steuern stimuliert werden. Auf die EZB zu setzen, bringt nicht viel, weil sie bereits alles tut, was in ihrer Macht steht, ohne dass es viel bringt. Forcierter Schuldenabbau in weiten Teilen der Wirtschaft bedeutet nicht zuletzt, dass die Geldpolitik impotent wird. Dies ist daher die Stunde der Finanzpolitik.
Eine neue Lohn-Preisspirale zeichnet sich jedenfalls nicht ab. Die EZB wäre glücklich, wenn es wenigstens erste Anzeichen dafür gäbe. Für sie hat sich vielmehr durch den Rückgang der Ölpreise das Risiko einer Deflation noch einmal erhöht. Eigentlich ist es positiv, wenn die Kaufkraft des Geldes zunimmt, nur ist das Problem, dass die reale Schuldenlast bei einem rückläufigen Preisniveau immer schwerer wird. Noch immer betrachten sich viele Staaten des Euroraums als überschuldet, ebenso wie viele Haushalte und Banken, und sie sind daher bestrebt, ihre Schulden loszuwerden oder zumindest deutlich zu vermindern. Inflation würde ihnen dabei sehr helfen – sie ist der größte Freund der Schuldner. Durch Sparen lassen sich aber keine höheren Inflationsraten hervorlocken.