Für die EZB ist die Exit-Strategie, also das Umschalten von der sehr expansiven auf eine „normale“ Geldpolitik, nichts, was sie um den Schlaf bringen wird. Wenn man sich als unbedarfter Laie die Entwicklung ihrer Bankbilanz und damit der sogenannten Geldbasis ansieht, kann einem dagegen schon bänglich werden. Wie kommt all das viele Geld, das in die Wirtschaft gepumpt wurde, eines Tages wieder in den Schlauch zurück? Es kann ja nicht ewig im Freien herumschwappen. Droht Hyperinflation, wenn nichts dagegen unternommen wird?
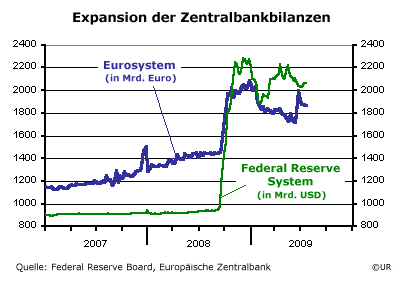
Für Herrn Trichet ist die Sache einfach. Wie er am 13. Juli in einer Rede an der Münchner Uni erläuterte, verfügt die EZB über einen gut sortierten Instrumentenkasten und wird daher in der Lage sein, flexibel und effektiv auf alle Herausforderungen zu reagieren. Vermutlich zu Recht ist er der Ansicht, dass die EZB, wenn die Zeit gekommen ist, die längerfristigen Refinanzierungsoperationen einfach auslaufen und/oder im Volumen verringern wird. Da gibt es keine Probleme wie beim Rückgängigmachen der gewaltigen Wertpapierankäufe, mit denen die Fed ihre Bilanz aufgebläht hat – die Reaktionen des Kapitalmarktes müssen in den USA nämlich mit ins Kalkül genommen werden. Im Vergleich dazu ist das Zurückschrauben des viel kleineren covered bond-Programms der EZB eine viel leichter zu bewältigende Aufgabe.
Trichet ist unter weniger Druck als sein Kollege Bernanke, von dem die Parlamentarier letzte Woche genau wissen wollten, wie seine Exit-Strategie denn nun aussieht. Anders als in Europa, wo die Geldpolitik und das Straßburger Parlament keinerlei Sexappeal haben und in den Medien weitgehend ignoriert werden, können die amerikanischen Abgeordneten mit kritischen Fragen zum Thema in der Öffentlichkeit punkten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Fed eine expansivere Politik verfolgt als die EZB, mit entsprechend größeren Risiken für die künftige Preisstabilität.
Im Grunde kann sich Herr Bernanke gar nicht konkret darüber äußern, unter welchen Umständen er das Ruder herumreißen würde. Auch wenn er dafür sehr kritisiert wurde. Erwartungsgemäß hat er nur die Instrumente beschrieben, über die er verfügt. Das ist natürlich der leichtere Teil der Frage zur Exit-Strategie.
Da der Kreditschöpfungsprozess auch in den USA nach wie vor blockiert und Inflation zur Zeit kein Thema ist, wird es, wie er betonte, für eine längere Zeit bei der akkommodierenden Geldpolitik bleiben. Auch diese Aussage fiel ihm leicht. Sie ist nicht kontrovers. Es besteht keinerlei Bedarf, irgendwann in der näheren Zukunft die Zinsen zu erhöhen. Es käme einem wirtschaftspolitischen Selbstmord gleich.
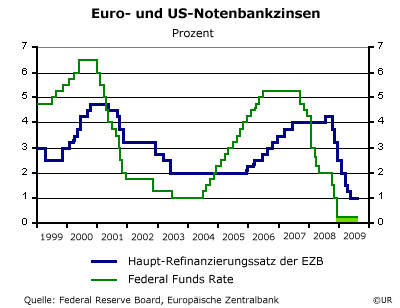
Das Problem mit der amerikanischen Exit-Strategie ist das Timing. Da wollte und konnte sich Herr Bernanke, ebenso wie übrigens Kollege Trichet für die EZB, nicht festlegen. Was ist beispielsweise zu tun, wenn die Wirtschaft zwar wieder Tritt gefasst und die Inflation zu steigen begonnen hat, gleichzeitig jedoch die langen Zinsen wegen der zweistelligen Haushaltsdefizite und des damit möglicherweise verbundenen crowding outs des privaten Sektors real bereits sehr hoch sind? Kann es sich eine Notenbank dann wirklich leisten, die kurzen Sätze anzuheben, auf diese Weise die Bondrenditen weiter in die Höhe zu treiben und so mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Runde der Rezession einzuläuten?
Es könnte auch sein, dass der Dollar zu dem Zeitpunkt, an dem die Wende eingeleitet werden soll, sehr fest ist. Wechselkurse werden nämlich häufig von internationalen Wachstumsdifferenzen getrieben. Würde eine weitere Aufwertung nicht dazu führen, dass sich das Leistungsbilanzdefizit erneut vergrößert und die USA sich erneut mit Problemen herumschlagen müssten, die längst als überwunden galten? Es könnte, wer weiß das schon, auch genau umgekehrt sein: Der Dollar wäre schwach, der Euro stark. Dann könnte die EZB zögern, die Zügel anzuziehen.
Die Frage wird auch sein, ob die Banken so gesund sein werden, dass sie einen Politikschwenk verkraften können. Der Gesundungsprozess zieht sich hin, da die Aktiva nur allmählich auf realistische Niveaus, also echte Marktpreise, abgeschrieben werden können. Es wird lange dauern, bis die europäischen und amerikanischen Bankensysteme wieder über genügend Eigenkapital verfügen. Die neuen Regulierungen zwingen sie übrigens auf prozyklische Art dazu, mehr Kapital vorzuhalten, als sie das gewohnt waren. Das schiebt den Zeitpunkt für einen geldpolitischen Kurswechsel tendenziell weiter in die Zukunft.
Ich halte die Debatte über das Timing des Strategieschwenks zur Zeit für wenig relevant und bin daher froh, dass sie bisher den Bewegungsspielraum der EZB nicht beeinträchtigt. Obwohl die Bilanzsumme der Frankfurter Notenbank, genauer: des Eurosystems, stark angestiegen ist und es an Liquidität wahrlich nicht mangelt, will die Kreditvergabe nicht anspringen.
Dem neusten Bank Lending Survey der EZB und der begleitenden Pressenotiz der Bundesbank, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, ist zu entnehmen, dass „die befragten Institute ihre Angebotsbedingungen erneut in allen Geschäftsbereichen verschärft“ haben, wenn diesmal auch nur leicht. „Die Margen hingegen wurden teilweise kräftig ausgeweitet. Die Anpassungen in Deutschland blieben dabei größtenteils hinter den entsprechenden Verschärfungen im gesamten Euro-Raum zurück.“
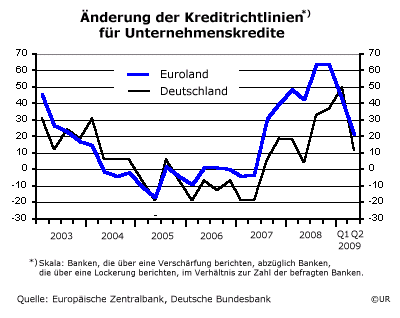
Die Banken reagieren damit auf die sich abschwächende Konjunktur und die schlechtere Kreditwürdigkeit ihrer Kunden. Andererseits ist aber auch die Nachfrage nach Krediten sehr schwach. Bei den Unternehmen sind dafür vor allem der Einbruch der Investitionen und der Lagerabbau verantwortlich, bei den Haushalten der rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit.
Das entspricht den Zahlen für die Kreditvergabe an den privaten Sektor: Saisonbereinigt stagnieren sie seit der Jahreswende und lagen im Juni nur noch um 1,5 Prozent über ihrem Vorjahreswert. Wenn sich der Trend fortsetzt, wonach es aussieht, wird es beim Kreditwachstum bald negative Vorzeichen geben.
Die Geldmenge M3 übertrifft ihren Vorjahresstand übrigens auch nur noch um 3,5 Prozent. Zur Erinnerung: Als Herr Issing vor mehr als zehn Jahren Chefvolkswirt der EZB wurde, hatte er für M3 eine Zielvorgabe von etwa 4,5 Prozent verkündet. Da gibt es jetzt also endlich Entwarnung, auch wenn die EZB von diesem monetaristischen Ansatz inzwischen deutlich abgerückt ist und sich daher kaum darüber freuen wird.
Das Inflationsziel von „etwas unter 2 Prozent“, das inzwischen im Vordergrund steht, ist auch nicht mehr realistisch. Gerade gab es die deutschen Inflationszahlen für Juli. Der Index der Verbraucherpreise ist gegenüber Juni saisonbereinigt offenbar um 0,5 Prozent zurückgegangen, trotz des teureren Benzins, und befindet sich jetzt um 0,6 Prozent unter seinem Vorjahresstand. Für Euroland gehe ich davon aus, dass die Inflationsrate im Juli -0,8 Prozent betrug.
In der Pipeline steckt zudem noch eine ganze Menge an Deflation: Die deutschen Einfuhrpreise sinken seit Monaten und waren im Juni um 11,3 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor; die industriellen Erzeugerpreise gehen seit Oktober mit einer annualisierten Rate von 9,6 Prozent zurück.
Bei den Stundenlöhnen und Gehältern scheint die Welt noch in Ordnung zu sein – sie steigen im Vorjahresvergleich mit Raten von über 3 Prozent, so dass real ein ordentlicher Zuwachs übrig bleibt. Das erklärt die Resistenz des privaten Verbrauchs in Deutschland und im Rest von Euroland. Das ist aber, da bin ich mir sicher, nur die Ruhe vor dem Sturm. Von nun an werden die Löhne mehr oder weniger stagnieren, einfach weil der Anstieg der Arbeitslosigkeit keinen anderen Schluss zulässt.
Es ist zwar wahrscheinlich, dass der europäische Konjunkturabschwung zunächst einmal beendet ist. Nach einem steilen Aufschwung sieht es aber überhaupt nicht aus, eher nach einer weiteren Zunahme der Outputlücke, dass heißt, nach Wachstumsraten unterhalb des Trendwachstums. Die Inflationsraten werden trotz aller expansiver Maßnahmen kaum steigen. Es ist diese Kombination: stabile oder sogar fallende Preise sowie steigende Arbeitslosigkeit, die die Geldpolitik genauso wie die übrige Wirtschaftspolitik auf Jahre hinaus dominieren wird. Über Exit-Strategien reden wir später.