Für manche Journalisten befindet sich die EZB im Krieg mit den Sparern, als sei es das Ziel der Geldpolitik, ihnen zu schaden. Einige Tage vor dem Beschluss der Notenbank, ab dem 8. Juni auch Unternehmensanleihen in ihr Ankaufsprogramm aufzunehmen, titelte Dennis Kremer von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, dass „Draghis nächste Attacke auf den Sparer beginnt“. Viele wittern eine Art Verschwörung hinter den Aktionen der EZB, zugunsten der Schuldner im „Club Med“ und zulasten der Sparer und Gläubiger in den Überschussländern des Nordens.
Dabei geht es der Europäischen Zentralbank darum, die Nachfrage durch niedrige Zinsen und günstige Kreditkonditionen anzukurbeln, sodass mehr produziert wird, neue Arbeitsplätze entstehen und die Investitionen stimuliert werden. Sie muss alles tun, damit die Inflationsrate endlich wieder auf ihren Zielwert von knapp unter zwei Prozent steigt. Die Zinsen sind so niedrig wie sie sind, weil sich die Inflationsrate um die Nullmarke bewegt und die ungenutzten Kapazitäten so groß sind, nicht weil die EZB aus irgendwelchen perfiden Gründen die Sparer bestrafen will. Dass sie zu immer unkonventionelleren Mitteln greift, jetzt also auch direkt in die Finanzierung der Unternehmen eingreift, ist nur eine Reaktion auf einige ungünstige Makrotendenzen wie die Stagnation der Produktivität, den anhaltenden Schuldenabbau nach dem Platzen der Schuldenblasen und die anhaltend große Produktionslücke.
Das Problem ist nicht zuletzt, dass die EZB von den übrigen wirtschaftspolitischen Akteuren alleingelassen wird. Sie ist einfach überfordert. Vor allem die deutsche Finanzpolitik lässt sie hängen. Das hat schon masochistische Züge. Was soll das Ganze? Wer braucht eigentlich eine „schwarze Null“, wenn nicht Inflation droht, sondern Deflation, und wenn die Anleger de facto bereit sind, dem Staat ihre Ersparnisse kostenlos zu überlassen? Weiß Herr Schäuble nicht, was sich mit billigen Krediten anfangen lässt?
Heute hat die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe 0,03 Prozent erreicht. Alle kürzeren Laufzeiten, angefangen von den BuBills des Bundes (-0,6 Prozent), über Tagesgeld (-0,4 Prozent), Eonia (-0,34 Prozent), 3-Monats-Libor (-0,28 Prozent), 5-jährige Pfandbriefe (-0,1 Prozent) bis zu 9-jährigen Bundesanleihen (-0,10 Prozent) weisen Minuszinsen auf. Am Rentenmarkt kommt es zunehmend zu Schweizer Verhältnissen – im Nachbarland haben die Zehnjährigen inzwischen -0,52 Prozent erreicht. Niemand behauptet dort übrigens, dass sich die Nationalbank im Krieg mit den Sparern befindet. Auch bei uns sollte mehr gewürdigt werden, dass es sich um vorübergehende, der Not geschuldete Maßnahmen handelt – und dass die Kaufkraft der Ersparnisse zwar nicht zunimmt, immerhin aber stabil ist.
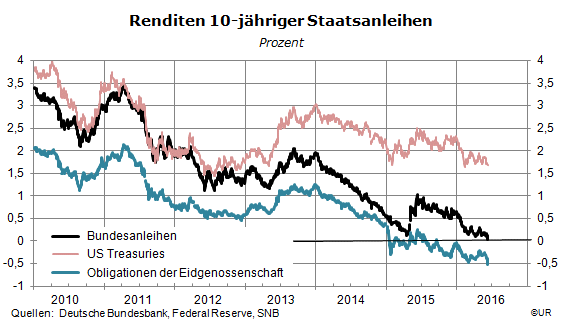
Auch wenn es für die Sparer grundsätzlich erfreulich wäre, wenn ihre Spareinlagen und Rentenpapiere anständige (Real-)Zinsen abwürfen, hat mir noch niemand erklärt, wie sie wieder steigen könnten – oder warum sie das sollten, jedenfalls in der jetzigen Situation. Ich weiß nur, dass für positive Realzinsen ein stärkerer Anstieg der Ausgaben, insbesondere für Investitionen erforderlich ist. Nur wenn Geld arbeiten kann, also rentabel in der Realwirtschaft eingesetzt wird, können die Kreditnehmer einen Teil ihrer Erträge an die Sparer weitergeben. Solange es daran hapert, werden die Sparer auf ihre Einlagen bei der Bank keine Zinsen bekommen und auf andere, riskantere, Anlageformen ausweichen müssen.
Sollten die Renditen der zehnjährigen Bundesanleihen tatsächlich weiter auf Schweizer Niveau fallen, also um 55 Basispunkte, käme es noch einmal zu beträchtlichen Kursgewinnen. Die Luft ist aber bereits heute sehr dünn. Es wäre eine Wette darauf, dass die Inflation tatsächlich längere Zeit in der Nähe von Null bleibt und der Euro weiter aufwertet. An den inflationsgeschützten Staatsanleihen lässt sich ablesen, dass die Marktteilnehmer in den nächsten zehn Jahren mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 0,6 bis 0,9 Prozent rechnen.
Obwohl ich glaube, dass die preisdämpfenden Faktoren im Euroraum weiterhin überwiegen werden – die große Produktionslücke, der anhaltende Schuldenabbau, die Aufwertung des Euro sprechen dafür –, könnte es sein, dass ihr Einfluss schwindet. Gestern gab es die neuen Zahlen zu den deutschen Arbeitskosten: Danach lagen die Bruttolöhne (je geleisteter Arbeitsstunde) im ersten Quartal um 3,2 Prozent über ihrem Vorjahresstand, das heißt real um nicht viel weniger. Der anhaltend kräftige Anstieg der Beschäftigung scheint sich nun doch in höheren Löhnen niederzuschlagen. Die Lohnstückkosten übertrafen im Unternehmenssektor ihr Vorjahresniveau immerhin noch um 2,2 Prozent. Nach wie vor gilt: keine allgemeine Inflation ohne Lohninflation. Wenn ich schon bei den Anzeichen für neue Inflationsrisiken bin: In den vier Monaten bis Mai haben sich die deutschen Verbraucherpreise, aufs Jahr hochgerechnet, um 2,0 Prozent erhöht und liegen damit auf dem Zielpfad.
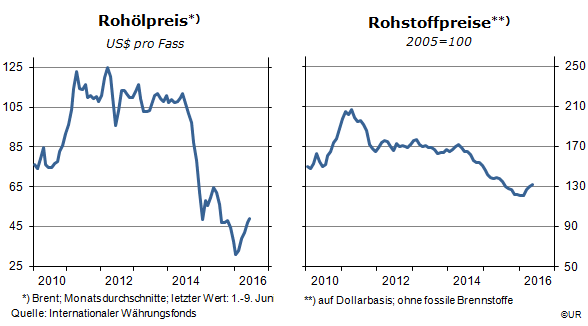
Die Inflation war bis Mitte Januar durch den Einbruch der Rohstoffpreise, insbesondere der Ölpreise, stark gedämpft worden. Auslöser war die schwache Nachfrage Chinas im Gefolge der allgemeinen Konjunkturflaute dort. Kein Land importiert so viele Rohstoffe wie China. Inzwischen hat sich am Markt eine gewisse Gelassenheit durchgesetzt – das Risiko einer richtigen Krise wird nicht mehr so hoch eingeschätzt (vielleicht etwas voreilig). Entsprechend kräftig haben sich die Rohstoffpreise erholt und wirken hierzulande, was das allgemeine Preisniveau angeht, zuletzt eher inflationär als deflationär. Das hat sich bereits auf die deutschen Einfuhrpreise ausgewirkt: Sie waren zwar im April noch um 6,6 Prozent niedriger als vor einem Jahr, seit Jahresbeginn sind sie aber lediglich mit einer Verlaufsrate von 1,6 Prozent gesunken und scheinen dabei zu sein sich zu stabilisieren.
Vermutlich ist es noch zu früh für eine Trendwende bei der Inflation, aber auszuschließen ist sie nach den jüngsten Entwicklungen nicht. Anleger sollten vor allem beobachten, wie es in China weitergeht. In keinem großen Land ist der private Sektor so hoch verschuldet und damit dem Risiko ausgesetzt, dass sich durch platzende Blasen an den Märkten für Immobilien und Infrastruktur eine Finanzkrise entwickelt, die das Land in die Rezession zieht. Sollte das am Ende doch passieren, ist höchste Eile geboten – die globale Deflationsspirale käme wieder in Gang. Und das hieße: zurück in die Festverzinslichen, größere Spreads zwischen den Bonitätsklassen, neue Probleme bei den Banken.
In die andere Richtung dürfte es gehen, wenn die US-Notenbank im Herbst den nächsten Schritt wagt und den Leitzins weiter anhebt. Das würde die US-Renditen erneut in die Höhe treiben. Da der deutsche Rentenmarkt eng mit dem amerikanischen korreliert ist, gäbe es auch hierzulande Aufwärtsdruck. Noch sieht es allerdings nicht danach aus, dass sich die Fed tatsächlich bewegen wird: Die aktuellen und die erwarteten Inflationsraten steigen zwar seit einiger Zeit und nähern sich der Marke von zwei Prozent, die Daten zur Konjunktur haben aber zuletzt stark enttäuscht, vor allem die für den Arbeitsmarkt und die Produktivität. Das ist auch der Grund für die Schwäche des Dollar und den Rückgang der Renditen am Dollar-Bondmarkt.
Sollten Anleger auf Aktien umsteigen? Damit wären sie aber ebenfalls nicht wirklich auf der sicheren Seite. Richtig ist, dass die Dividendenrendite – 2,2 Prozent beim Dax, ebenfalls 2,2 Prozent beim S&P 500 – deutlich attraktiver ist als die heutigen Bondrenditen. Aber Aktien sind nicht billig. Laut Bloomberg erwarten die Analysten, dass das durchschnittliche Kurs-Gewinnverhältnis (KGV) des Dax von 21,75 auf der Basis der Gewinne der vergangenen vier Quartale auf 12,65 auf der Basis der für dieses Jahr erwarteten Gewinne zurückgehen wird: Das entspricht einem Anstieg der Gewinne um nicht weniger als 72 Prozent. Das ist völlig illusorisch.
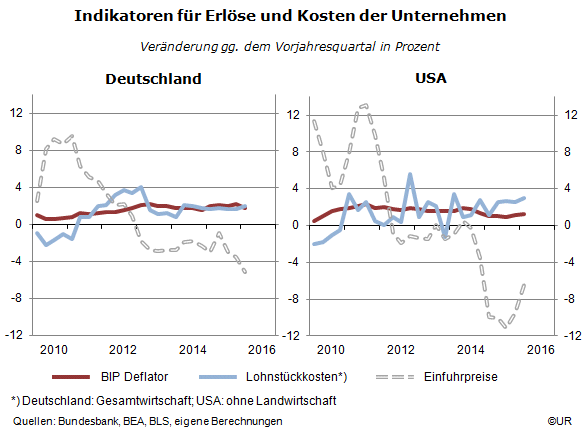
Nur mal überschlägig gerechnet: Der BIP-Deflator, also das breiteste Inflationsmaß und damit eine Art Indikator für die Stückerlöse, dürfte in diesem Jahr gegenüber 2015 um 1,8 Prozent steigen. Auf der Kostenseite nehmen die Lohnstückkosten, wie erwähnt, dagegen mit einer Rate von 2,2 Prozent zu. Für sich genommen führt das zu einem leichten Rückgang der Stückgewinne. Andererseits dürften die Einfuhren, der andere, wenn auch weniger wichtige Kostenfaktor, im Jahresdurchschnitt um drei Prozent billiger sein als 2015, so dass es insgesamt vielleicht zu einem leichten Anstieg der Stückgewinne kommen wird, auf gar keinen Fall aber um die besagten 72 Prozent. Enttäuschungen sind also vorprogrammiert, vor allem wenn der Euro seine Aufwertung fortsetzt.
Amerikanische Aktien sind vielleicht eine Alternative: Die Gewinnerwartungen von plus neun Prozent (2016/2015) sind moderat und daher realistischer als die deutschen (und europäischen allgemein), aber die Papiere sind sehr teuer. Das KGV des S&P 500 mit den erwarteten Gewinnen für 2016 liegt bei stolzen 18 und damit weit über dem historisch Normalen. Wer US-Aktien kauft, wettet im Grunde auf eine Abwertung des Dollar. Ich selbst halte sie für überfällig und würde daher nicht davon abraten, alle amerikanischen Aktien zu verkaufen.
Vorläufig sind deutsche Immobilien die beste, wenn auch oft arbeitsintensive Anlagealternative. Die Anzahl der Haushalte und damit der Bedarf an zusätzlichem Wohnraum nehmen kräftig zu, so dass die Mieten für neue Wohnungen auf absehbare Zeit weiter steigen sollten. Eine Rendite von über vier Prozent dürfte möglich sein.
Mario Draghi mag die Sparer bekämpfen, er belohnt aber alle, die sich für den Kauf von Eigentumswohnungen und Häusern verschulden.