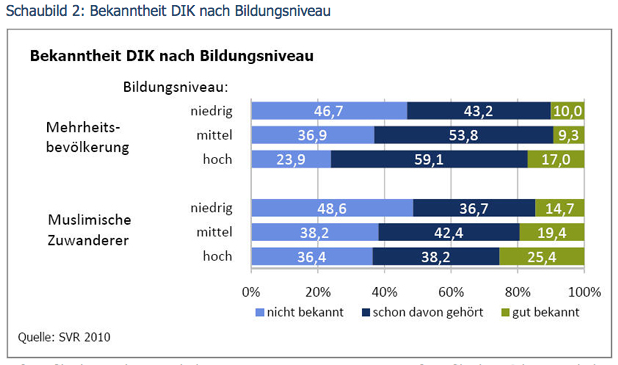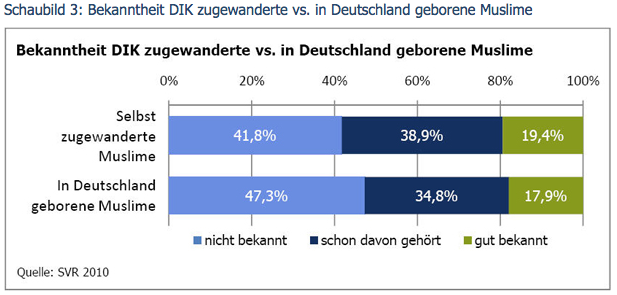Der große israelische Philosoph und Diplomat Shlomo Avineri erklärt in Ha’aretz, warum einige seiner Verwandten sich nicht aus dem NS-beherrschten Polen nach Palästina retten konnten – wegen der erfolgreichen arabischen Opposition gegen die jüdische Einwanderung in der „dunkelsten Stunde des Judentums“.
„They succeeded in shutting the country’s gates during the darkest hour of the Jewish people. Anyone seeking reconciliation between us and the Palestinians must insist that both sides be attentive to the suffering of the other side, and that goes for the Palestinians as well as for us.“
Die damals in Palästina herrschenden Briten entschieden sich zum Appeasement gegenüber der arabischen Revolte, um den Nachschubweg aus Indien über den Suez-Kanal nicht zu gefährden. Man fürchtete, dass sich die Araber durch fortgesetzte gewaltsame Unterdrückung der Revolte zusammenschließen und näher an Nazideutschland und das faschistische Italien rücken würden. Die Briten deckelten darum im White Paper 1939 die jüdische Einwanderung bei 75.000 und erschwerten den Immobilienerwerb für Juden in Palästina.
Die Appeasement-Politik hat den Mufti von Jerusalem nicht davon abgehalten, dennoch die Nähe Hitlers zu suchen:
„This policy did not completely achieve its goal; the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, found his way to Berlin anyway. An anti-British and pro-Nazi rebellion erupted in Iraq, led by Rashid Ali. But as far as the Jews were concerned, the British continued to consistently apply the principles of the White Paper during the war. The gates were shut to legal Jewish immigration, the British navy fought illegal immigration and ships seeking to save Jews from the Nazi occupation (such as the Struma) were returned to their port of origin; some of their passengers died at sea, others in the gas chambers.
Guilt for the Holocaust lies with Nazi Germany and its allies. But an untold number of Jews, perhaps as many as hundreds of thousands – including my grandparents from the Polish town of Makow Podhalanski – were not saved and did not reach Mandatory Palestine because of the position taken by the Arabs.“
Avineri will vor allem ein Argument entkräften, dass man immer wieder in Debatten über die Legitimität Israels zu hören bekommt: „Warum mussten die Araber für den NS-Holocaust mit dem Verlust ihrer Heimat büßen?“
„One sometimes encounters the Palestinian argument that there is a basic injustice in the fact that they appear to have to pay the price for Europe’s crimes during the Holocaust. It’s true, of course, that Nazi Germany and its allies, and not the Palestinians, are those guilty of perpetrating the Holocaust. Nonetheless, any argument that links the establishment of the State of Israel exclusively to the Holocaust ignores the fact that modern Zionism preceded the annihilation of the Jews in World War II, even if the Holocaust clearly strengthened the claim for Jewish sovereignty.“
Die zionistische Einwanderung nach Palästina ging dem Holocaust erstens lange voraus, und zweitens hätten die Araber durch ihre Opposition gegen die jüdische Einwanderung ausgerechnet zur Zeit der schlimmsten jüdischen Bedrängnis eine Mitverantwortung für viele Opfer auf sich geladen.
Avineri hat Recht, an diesen dunkle Vorgeschichte der Staatsgründung Israels zu erinnern. Man sieht hier, dass sehr viel mehr einer Aussöhnung im Wege steht als nur die Ereignisse der letzten Jahre.
Aber Empathie ist eben eine Sache auf Gegenseitigkeit. So lange eine isarelische Politik herrscht, die den Arabern Palästinas jedes Mitgefühl für ihre Katastrophe in Folge der Staatsgründung Israels verweigert, kann man kaum erwarten, dass jene der jüdischen Tragödie mit Empathie begegnen.