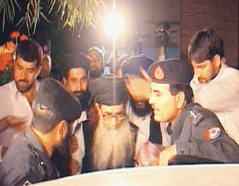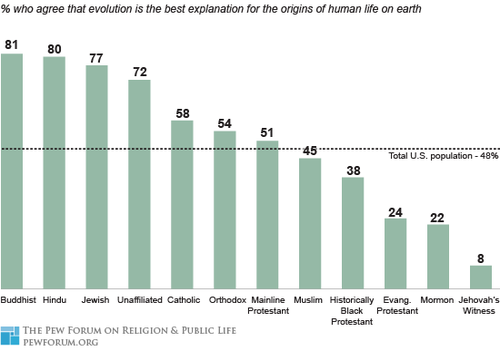Mir als Kind von Vertriebenen, die von ihrem Verlust nie großes Aufhebens gemacht haben, ist es schmerzhaft zu sehen, wie die Vorsitzende des „Bundes der Vertriebenen“ – Erika Steinbach – das Gedenken an die Verbrechen für ihre persönlichen Zwecke und für die ihres Verbandes instrumentalisiert.
Steinbach macht die Erinnerung an Vertreibung und Reintegration von Millionen schwierig. Sie diskreditiert ein Thema, das immer noch nicht zuende erfroscht und bedacht ist.
Vor fast 5 Jahren habe ich sie getroffen und porträtiert. Seit meinem Text von damals hat sich leider nichts verändert, wie die jetzigen Querelen um Steinbach zeigen. Darum hier noch einmal mein Text aus der ZEIT vom 27. Mai 2004:
Mit dem Naziüberfall kam Erika Steinbachs Vater nach Westpreußen. Dieses Detail ihrer Vertreibungsgeschichte wurde erst bekannt, als polnische Zeitungen darüber schrieben. Die CDU-Bundestagsabgeordnete und Vertriebenenfunktionärin Erika Steinbach hat das Pech, eine hoch gewachsene, elegante Blondine zu sein, die sich für antideutsche Propaganda der dümmsten Art geradezu anbietet. Im letzten Herbst prangte sie, in eine SS-Uniform montiert und auf dem Bundeskanzler reitend, auf dem Titel eines polnischen Nachrichtenmagazins. Hat es ihr nichts ausgemacht, derart zur Hassfigur stilisiert zu werden? „Ach, wissen Sie, ich kann einfach keinen Groll empfinden. Letztlich müssen die Polen selber damit klarkommen.“ So einfach liegen die Dinge nicht: Vor einigen Jahren hat ein anderes polnisches Blatt enthüllt, dass Erika Steinbachs Familie erst mit der deutschen Besatzung nach dem Überfall auf Polen ins westpreußische Rahmel gekommen war. Ihr Vater, aus Hanau stammend, war als Wehrmachtssoldat in Rahmel – polnisch Rumia – stationiert worden. Die Mutter war Anfang der vierziger Jahre aus Bremen übergesiedelt.
Warum hat Erika Steinbach, seit 1998 Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, nicht selber ihre Familiengeschichte offen gelegt? Was ihre Mutter mit zwei Kindern auf der Flucht über die Ostsee, nur ein Schiff nach der untergegangenen Gustloff, erlebt hat, ist ja auch so schlimm genug – Hunger, Enteignung, Erniedrigung. Erika Steinbach hätte aus einem offensiven Umgang mit ihrer Herkunft bei den Polen Vertrauen gewinnen können.
„Denen, die jetzt sagen, ich sei gar keine echte Heimatvertriebene, antworte ich: Ich würde mir wünschen, dass unser nächster Vorsitzender überhaupt keine familiäre Verbindung zu dieser Geschichte hat. Die Sache geht ohnehin alle Deutschen etwas an.“ Sie schaut einen intensiv und einvernehmend an, wenn sie solche Dinge sagt, und man merkt, dass sie das Thema damit wirklich für beendet hält. Wenn die Polen sich daran stoßen, dass die Tochter eines Besatzungssoldaten ihnen im Namen der Vertriebenen großmütig Vergebung anbietet, so fällt das, meint Steinbach, auf diese selbst zurück. Ach, wenn bloß die lästigen Polen nicht wären, das Gedenken wäre ein Kinderspiel.
Empathie ist nicht Erika Steinbachs Stärke. Aber sie hat gemerkt, daß irgendeine Geste in Richtung Polen an der Zeit ist. Daraus ist gleich wieder eine neue Gedenkidee entstanden: Die Vertriebenen wollen im Französischen Dom zu Berlin eine Gedenkfeier zum Warschauer Aufstand abhalten, der am 1. August vor 60 Jahren begann. „Wir wollen zeigen, dass wir Anteil nehmen auch an polnischem Leid“, sagt Erika Steinbach. Damit wäre den Gegnern des von ihr und Peter Glotz initiierten „Zentrums gegen Vertreibungen“, hofft sie, der Wind aus den Segeln genommen. Nur leider spielen die Polen wieder nicht mit. Steinbach ist es unbegreiflich, dass die Polen ihre Feier als ungehörige Instrumentalisierung eines nationalen Gründungsmythos betrachten. Beim Warschauer Aufstand wurden 200 000 Menschen, mehrheitlich Zivilisten, von den deutschen Besatzern getötet, anschließend die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Die geplante Gedenkfeier nennen selbst besonnene Kommentatoren wie der Deutschlandkenner Adam Krzeminski eine „Provokation“.
Doch Erika Steinbach sieht sich im Recht, und sie wird ihre Sache durchziehen, mit allen Schikanen der deutschen Gedenkkultur, ob es den Polen passt oder nicht. Was auch immer Steinbach anpackt, verfolgt sie mit terminatorhafter Entschlossenheit. Bei dem Zentrumsprojekt komme man gut voran, man stehe in Verhandlungen um eine Immobilie in Berlin: „Nur weil die Polen sich aufregen, können wir dieses große Thema doch nicht fallen lassen.“
Soeben ist Erika Steinbach zum dritten Mal als Präsidentin wiedergewählt worden. An diesem Pfingstwochenende, bei den traditionellen Vertriebenentreffen, wird sie gefeiert werden. Tatsächlich hat sie den Bund der Vertriebenen aus der politischen Paria-Existenz geführt. An die Stelle des Muckertons der frühen Jahre ist in ihrer Amtszeit ein selbstbewusster, konfrontativer Stil getreten. Es ist kein geringes Verdienst, die Vertriebenenverbände zugleich aus der Ecke der Ressentimentpolitik geholt zu haben. Steinbach hat erstmals einen notorischen Auschwitzleugner als Funktionsträger abwählen lassen („Glauben Sie mir, das war nicht einfach!“). Sie hat ihren Verband mindestens verbal von der „Preußischen Treuhand“ distanziert, einem Club Ewiggestriger, der in den Beitrittsländern mit Restitutionsforderungen Angst und Schrecken verbreitet (siehe Dossier, Seite 15-18). Es ist ihr mit großem Geschick gelungen, das seit der Ostpolitik eingefrorene Verhältnis zur Sozialdemokratie aufzutauen. Sie hat Otto Schily und Gerhard Schröder als Gastredner auf dem „Tag der Heimat“ gewinnen können. Peter Glotz sitzt mit ihr gemeinsam der Stiftung vor, die das „Zentrum“ errichten will. Ralph Giordano, Joachim Gauck und Lothar Gall unterstützen das Vorhaben. Weiter„Erika Steinbach – Gedenken mit Schmiss“