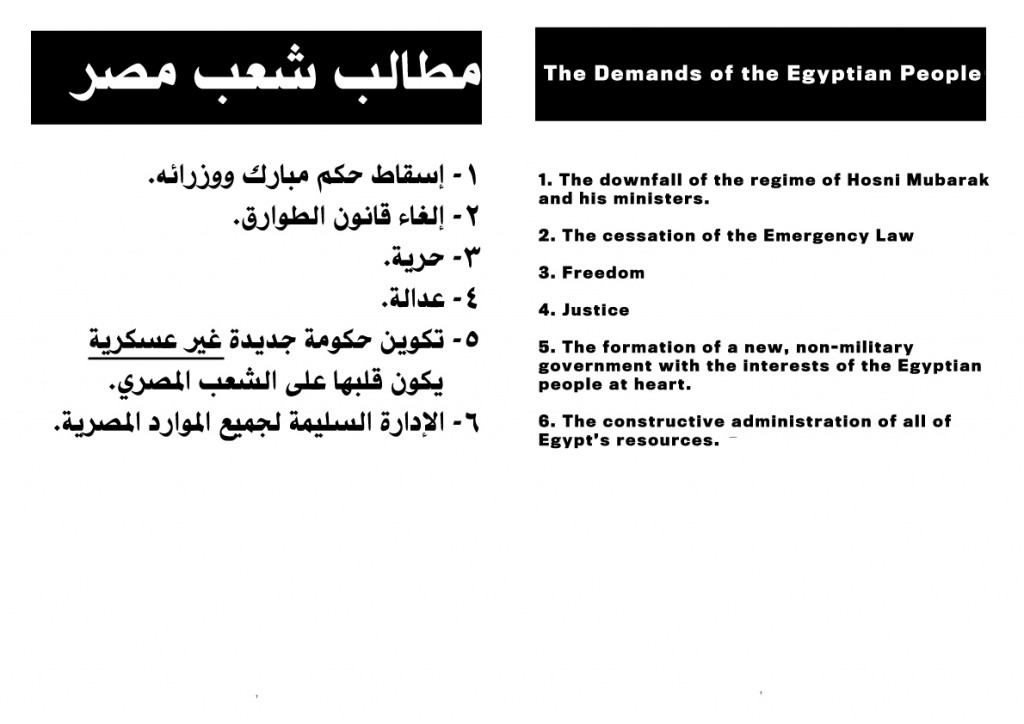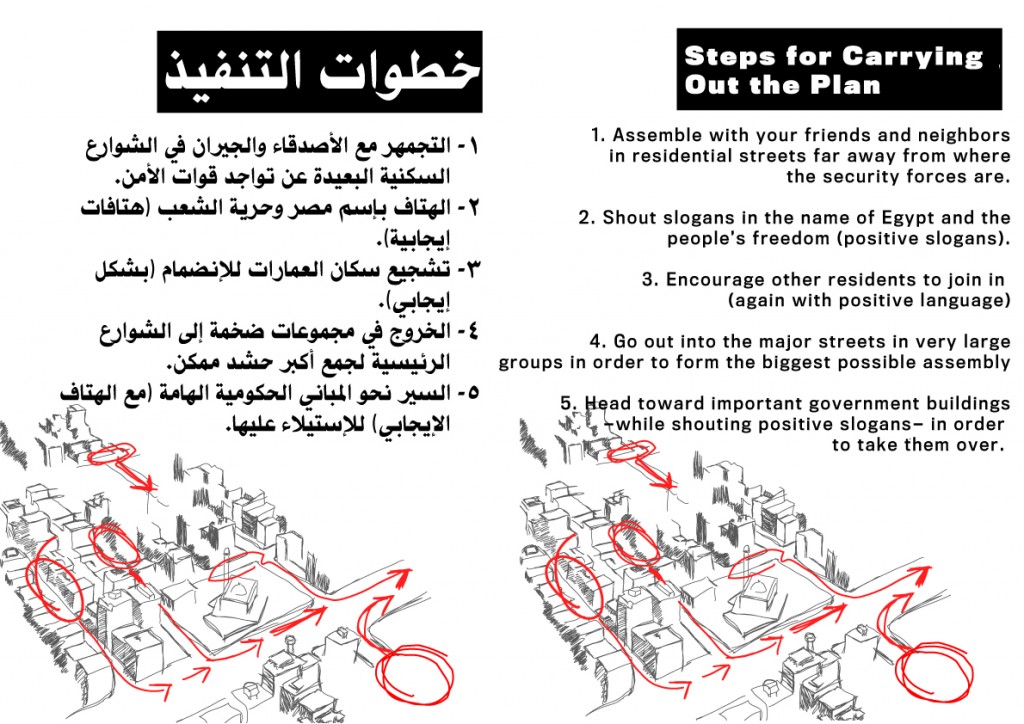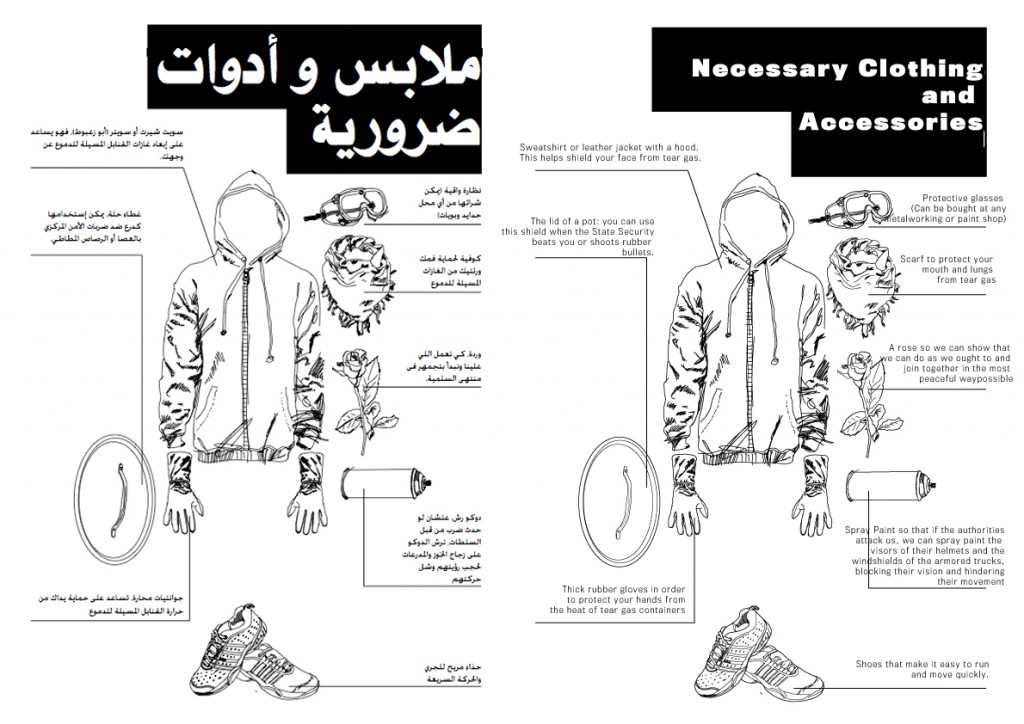Bei der Sicherheitskonferenz in München ist eine interessante Arbeitsteilung der westlichen Politiker zu beobachten. Während Europäer und Amerikaner in Regierungsämtern das Codewort „transition“ gebrauchen, immer öfter in Kombination mit „rapid“, bleibt es dem republikanischen Senator John McCain überlassen, Präsident Mubarak direkt zum Rücktritt aufzurufen. Er muss gehen, seine Zeit ist vorbei, sagt McCain ungerührt, nachdem er Mubaraks Verdienste („Partner“,“Stabilität“) herausgestellt hat. Und vielleicht ist das ja auch richtig so: Es kann nicht die Aufgabe westlicher Regierungen sein zu sagen, wer in Ägypten zurücktreten und wer die Regierungsverantwortung übernehmen müsse. So sagt es David Cameron, der britische Premier. Auch Angela Merkel folgt dieser Linie.
Sie bringt allerdings selber die Parallele zum Mauerfall auf und zieht damit erstmals eine Parallele von ihrem Erleben des Endes der DDR zu den Ereignissen in der arabischen Welt. Das ist eine starke Botschaft, die den Freiheitswillen der arabischen Völker ernst nimmt und die Revolten in diesem Teil der Welt als historische Schwelle wertet. (Schwelle wohin? Niemand will hier Wetten annehmen.)
Allerdings bringt Merkel ihre Erinnerung an den Umbruch in der DDR auch ins Spiel, um eine Lektion der Mäßigung loszuwerden: Wenn man in einem solchen Umbruch ist, sagt sie, könne es nie zu schnell gehen. Aber es wäre wichtig, statt auf sofortige Wahlen zu setzen, erst die Strukturen aufzubauen, die ein demokratisches politisches System braucht. Dahinter steht die Furcht, dass in Ägypten einzig die Muslimbrüder über die Organisationsstrukturen und die Disziplin verfügen, um bei Wahlen erfolgreich zu sein.
Merkel hat die Lektion aus dem amerikanischen Projekt gezogen, in Palästina freie Wahlen durchzuführen, an denen dann auch die Hamas teilnehmen durfte (sogar ohne vorheriges Bekenntnis zum Gewaltverzicht): Demokratie kann man nicht durch freie Wahlen alleine aufbauen. Man kann sie sogar durch zu frühen Wahlen ohne Bedingungen im Kindbett ersticken. Vielleicht sollten freie Wahlen erst am Ende eines Wandels stehen. Aber es ist leicht, über solche Dinge zu philosophieren: Jeder hier weiß, dass nicht die Mächtigen im Bayerischen Hof darüber bestimmen werden, sondern die Ägypter selber.
Aber es gibt eine Botschaft aus München nach Ägypten: Sofortiger Rückzug Mubaraks (ohne dass westliche Regierungen ihn direkt dazu auffordern, was ja auch der Demokratiebewegung schaden würde, weil es sie ins Licht ausländischer Einflussnahme stellen würde). Sofortiger, „geordneter“ Übergang zu einem demokratischen System mit Einbeziehung aller Kräfte. Keine Gewalt (Deutschland hat unter dem Eindruck der Ereignisse von vorgestern auf dem Tahrir-Platz schon weitere Rüstunsgkooperation ausgesetzt). Die EU und die USA werden in Zukunft stärker mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten, um den Aufbau der Demokratie von unten zu forcieren.
Aber man wird sich mit direkten Ratschlägen zurückhalten. Merkel erzählt dazu, wie empfindlich seinerseits die DDR-Opposition nach der Wende auf gute Ratschläge aus Westdeutschland reagiert hatte: „Da hat man sich auf dem Hacken umgedreht und es gerade nicht so gemacht wie empfohlen. Und das war unter Deutschen.“ Um so mehr, so wollte Merkel suggerieren, müssten sich die Ägypter heute durch gute Ratschläge von Seiten der Mächte bevormundet fühlen, die noch bis vor zwei Wochen gut mit Hosni Mubarak zurecht gekommen sind. Da ist etwas dran. Aber es liegt darin auch die Gefahr einer bequemen Ausrede fürs Unentschiedenheit und Nichtstun.