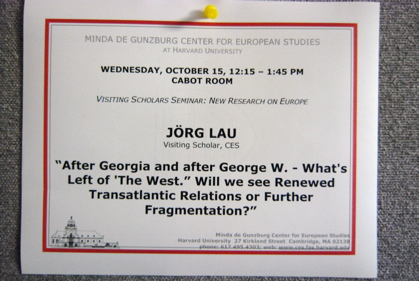„Allerdings muß ich eine Sache klarstellen, ich bin kein Republikaner. Ich habe 1992 Clinton gewählt, und 2000 Gore. An mir hat’s also nicht gelegen, dass Bush Präsident wurde. ich möchte gerne Demokrat sein, finde mich dann aber doch auf der anderen Seite wieder.“
Ist ja Interessant!
Dinner mit Robert Kagan im Harvard Faculty Club, nur 5 Tage vor der Wahl. Kagan, einst einer der führenden Neocons, ist sichtlich um Abstand zum amtierenden Präsidenten bemüht. Und ein Neocon möchte er eigentlich auch nicht (mehr) sein.
Robert Kagan Foto: Carnegie Endowment
Vor einem kleinen Kreis von Historikern, Ökonomen und Gästen der Universität erläutert Kagan die Thesen seines neuen Buchs („The Return of History and the End of Dreams“), das ich hier schon länglich diskutiert habe.
Kagan ist ein pointierter und witziger Redner. Seine These, dass wir nach dem „unipolaren Moment“ – in dem die USA kurzzeitig konkurrenzlos schienen (nach dem Ende des Kommunismus) – zum geopolitischen Normalzustand zurückgekehrt seien, in dem große Mächte (inkl. Rußland, China, Indien) wieder um Ressourcen, Respekt und Einfluß konkurrieren, wurde von vielen Seiten in Frage gestellt.
Er konnte sie gut verteidigen, allerdings bleiben einige wichtige Fragen offen.
Ein interessanter Aspekt von Kagans Weltsicht ist folgender: Der Konflikt mit dem islamischen Radikalismus tritt sehr weit in den Hintergrund. Interessant für einen Denker, der die USA nach dem 11. September mit dazu getrieben hat, zwei Kriege im Herzen der islamischen Welt zu beginnen, und der die Demokratisierung der islamischen Welt zum wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer Erneuerung der Region erklärte.
Heute sagte Kagan in Harvard: „Die Führer der radikalen Islamisten, ob es nun Chamenei im Iran oder die Sprecher der Qaida sind, gerieren sich vielleicht darum immer radikaler, weil ihre Bewegung sich auflöst und ihr historischer Kampf aussichtslos ist. Die amerikanische Aussenpolitik kann nicht um diesen Konflikt herum gebaut werden. Der radikale Islam sollte uns eher wenig Sorge bereiten (should be a rather low level concern). Nur die Möglichkeit eines weiteren fatalen Anschlags in den USA zwingt uns paradoxer Weise, die Sache ernster zu nehmen.“
Das ist für meinen Geschmack eine Kehrtwende. Kagan kritisierte in Harvard explizit Senator McCains Bezeichnung des Konflikts mit den Dschihadisten als „transzendentale Bedrohung“ unserer Zeit. (Kagan hat McCain beraten und eine Rede für ihn geschrieben.) Was ist bloss aus der Neocon-Idee geworden, den Modernisierungsstau der islamischen Welt, dessen Resultat der islamistische Terrorismus ist, mit einem Schlag zu lösen? Man möchte doch gerne wissen, wann genau diese Idee über Bord gegangen ist.
Ich hätte mir gewünscht, dass Robert Kagan ein wenig darauf eingegangen wäre, was ihn zum Umdenken bewegt hat. Aber das ist nun mal nicht seine Art.
Überhaupt scheint die Hauptlinie seiner Argumentation nun nicht mehr Amerikas Sonderrolle und Mission zu sein, sondern die Unvermeidlichkeit „normaler“ Staatenkonflikte, in denen sich die USA eben wie eine Großmacht unter anderen verhalten, während Europa immer noch in der Illusion lebt, diese Welt durch Kooperation und Souveränitätsverzicht hinter sich gelassen zu haben.
Darum seien die Europäer auch unfähig, sich mit einem Rußland auseinanderzusetzen, das ganz altmodisch Anspruch auf Macht und Einflußsphären erhebe. (Was Amerika Putin nach dem Georgien-Konflikt ausser ziemlich hohlen Drohungen entgegenzusetzen hatte, blieb Kagan allerdings schuldig.)
Ein starker Punkt Kagans ist die Warnung, dass wir uns nicht allzu harmoniesüchtig vorstellen sollten, dass Handel und Interdependenz im Zeichen der Globalisierung automatisch eine Ära des ewigen Friedens einläuten. Es gebe, sagte er, eine „fantastische Vielfalt von Ordnungen der Unfreiheit, die wir einfach nicht mehr zur Kenntnis nehmen, weil wir auf die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts eingepeilt sind“. Zweifellos seien die Menschen in China und Rußland heute freier denn je als Individuen. Aber die entscheidende Frage sei doch, ob es in beiden Ländern politische Freiheit im Sinne eines offenen Wettbewerbs um die Macht gebe. Die Antwort sei zweimal nein.
Mein Hauptproblem mit Kagans Perspektive ist dies: Seine „Wiederkehr der Geopolitik“ stellt Interessenskonflikte bis zum Krieg hin als das schlicht Unvermeidliche hin, in einem Ton des heroischen Realismus.
Manche Konflikte sind aber eben aus Realismus unbedingt zu vermeiden – und Kagan gibt keinerlei Kriterien an für eine kluge Politik in diesem Sinn. Im Gegenteil: Er stellt den „großen Mächten“ einen Freifahrtschein aus, ihre Interessen um jeden Preis zu verfolgen. (Seine Sicht ist offensichlich apologetisch: immer wieder läuft alles darauf hinaus, dass die USA genau so handeln mussten, wie sie handelten.)
In der Welt, in der wir heute leben, ist das Handeln nach dem nationalen Interesse als einzigem Kriterium aber eben nicht mehr realistisch. Die drei dringendsten Probleme – Finanzkrise (Wirtschaftskrise), Energiekrise und Umweltkrise – lassen sich so nicht lösen. Weder eine neue Weltfinanzarchitektur, noch die Sicherung des Weltenergiebedarfs, noch ein Übereinkommen zur Emmissionsbegrenzung lassen sich auf der Ebene einzelstaatlichen Handelns herbeibringen.