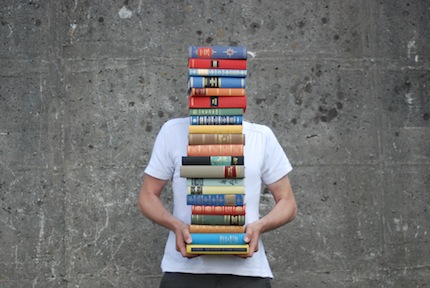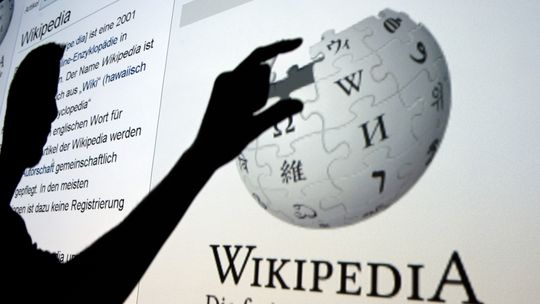Die Ressourcen unseres Planeten sind hart umkämpft. Denn Kohle, Erdöl und Erdgas liefern Energie, die chemische Industrie verwertet Rohstoffe wie Kalk oder Salz. Verbraucher sollten sich daher des Stellenwertes dieser Stoffe bewusst sein, Politik und Wirtschaft müssen ihre Bewirtschaftung und Verteilung weltweit regeln.
Das gilt besonders für Wasser. Auch wenn deutsche Haushalte immer weniger Wasser aus dem Wasserhahn verbrauchen, verschlingt die Herstellung von Konsumgütern große Mengen des “blauen Goldes“ – und das stammt oft aus Ländern, in denen Wassermangel herrscht. Bald könnte es auch einen Mangel an fossiler Energie geben, die aus Braunkohle, Erdgas und Erdöl gewonnen wird, meinen Wissenschaftler. Der Energieforscher Mikael Höök geht sogar davon aus, dass das Förderungsmaximum bereits erreicht ist.
Zu den fossilen Stromlieferanten gibt es zwei Alternativen: Zum einen die erneuerbaren Energien wie Wasser-, Wind- und Sonnenkraft sowie Erdwärme und Biogas. Diese Energiearten sind unbegrenzt vorhanden. Die zweite Alternative ist die Atomenergie. Seit den 1960er Jahren gewinnen Kraftwerksbetreiber mittels einer Kernreaktion Energie, überwiegend aus Uran. Diese Energiegewinnung gilt als sauber, effizient und gleichzeitig klimafreundlich. Aber der anfallende Atommüll ist ein großes Problem, weil unklar ist, wie er sicher endgelagert werden kann. Darüber hinaus besteht die Gefahr einer atomaren Katastrophe, wenn es in einem Atomkraftwerk zu einer Kernschmelze kommt.
Infolge der Atomkatastrophe in Japan hat die Bundesregierung beschlossen, bis 2022 aus der Atomenergie auszusteigen. Nach einer Studie des Weltklimarats ist es möglich, dass im Jahr 2050 drei Viertel der global benötigten Energie aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse und Erdwärme gewonnen werden können. Ingenieure sind aber uneinig, wie der Ausbau erneuerbarer Energien am besten gelingt. Da der Atomausstieg beschlossen ist und Kohlekraftwerke laut Energieexperten das Klima schädigen, ist der Umstieg auf die erneuerbaren Energien aber notwendig.
Um zu dokumentieren und analysieren wie sich das Klima verändert, haben die Vereinten Nationen und die Weltorganisation für Meteorologie 1988 das Intergovernmental Panel on Climate Change, genannt Weltklimarat, gegründet. Er erstellt Studien über die Ursachen und Auswirkungen weltweiter Klimaveränderungen, etwa über den Treibhauseffekt.
Auf dieser Seite finden Schüler Materialien über die verschiedenen Ressourcen und Texte zu den verschiedenen Formen der Energiegewinnung und zum Klimawandel.
Einführende Materialien zu Ressourcen
Natürliche Ressourcen (eea.europa.eu)
Die natürlichen Ressourcen sind für das Überleben und die Entwicklung des Menschen lebenswichtig. Warum ist das so? Was ist eine natürliche Ressource? Welche sind erneuerbar und wie können wir sie nutzen? Eine kurze Einführung
Management natürlicher Ressourcen (gtz.de)
Boden, Wasser, Vegetation und Biodiversität sind Lebensgrundlagen. Warum das so ist und wie die nachhaltige Bewirtschaftung aussehen sollte, erklärt die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit.
Rohstoffe – Die neuen Herren der Welt (ZEIT ONLINE, 29.10.2010)
Der Kampf um Rohstoffe wird zur Überlebensfrage der deutschen Industrie. Um den High-Tech-Standort zu retten, müssen sich Unternehmen und Politik grundlegend ändern.
Rohstoffroulette (spiegel.de)
Kupfer, Uran und Reis sind drei wichtige Rohstoffe auf unserem Planeten. Die interaktive Grafik zeigt die Fördermengen, wie hoch der Verbrauch ist und wie sich der Preis von 2005 bis 2011 verändert hat.
Kostbares Wasser
Wie viel Wasser verbrauchen wir? (DIE ZEIT, Nr. 26/2009, Infografik)
Deutsche Haushalte verbrauchen seit den achtziger Jahren immer weniger Wasser. Viel größere Mengen verschlingt die Herstellung von Konsumgütern. In denen steckt „virtuelles Wasser“. Hier erfahren Schüler, was das bedeutet und wie viel Wasser wir benötigen.
Unser täglich Wasser (DIE ZEIT, Nr. 30/2009)
Stehlen wir den Armen das Wasser? Duschen ohne Ende – kein Problem? Wird es einen Krieg um Wasser geben? Antworten auf die drängenden Fragen rund um die Wasserkrise.
„Wir müssen die Globalisierung stoppen“ (ZEIT ONLINE, 1.12.2010)
„Das Süßwasser wird in unglaublicher Geschwindigkeit knapp“, sagt die Trägerin des Alternativen Nobelpreises, Maude Barlow. Die Umweltschützerin erklärt, warum wir für das Recht auf Wasser kämpfen müssen.
Virtuelles Wasser (virtuelles-wasser.de)
Der Begriff “virtuelles Wasser“ beschreibt, wie viel Wasser Hersteller brauchen, um ein Produkt fertigzustellen. Der Ratgeber zeigt, welche Produkte wasserschonend und welche wasserintensiv sind. Zudem gibt es Infos zum Wasserfußabdruck ausgewählter Länder und wie sich dieser zusammensetzt.
Fossile Energien und die Diskussion über den Peak Oil
Wettlauf der Brennstoffe (Quarks & Co, Video)
Braunkohle, Steinkohle, Erdgas oder Kernkraft: Welcher Brennstoff erzeugt den umweltfreundlichsten Strom und stößt am wenigsten CO2 aus?
Wie lange reicht die Kohle? (wissenschaft-online.de)
Kohle lieferte im Jahr 2008 ein knappes Drittel der weltweiten Primärenergie. Nur Erdöl ist eine wichtigere Ressource. Geht uns die Kohle in den nächsten Jahrzehnten aus?
Multitalent Erdöl (Planet Schule, Video)
Ob Fernseher, CD oder Gummisohlen: Die industrielle Produktion hängt am Erdöl. Das Video erklärt, wie das schwarze Gold vor 150 Millionen Jahren entstanden ist. Weitere Videos zeigen, wie Unternehmen Bohrstellen finden, wo Sie Öl fördern und wie die Ölförderung die Umwelt belastet.
Simulation zur Erdölreichweite (Planet Schule, Interaktive Grafik)
“Peak Oil“ heißt der Moment, in dem das globale Ölfördermaximum erreicht ist. Die Simulation zeigt, wie die Zukunft nach dem “Peak Oil“ aussehen könnte.
Erdöl – Berg- oder Talfahrt? (spektrum.de)
Pessimisten meinen, dass die globale Ölproduktion in den kommenden Jahren ihren Höhepunkt erreichen wird und dann zurückgeht. Weiterentwickelte Fördertechnologien liefern jedoch neue Möglichkeiten zur Ölproduktion.
Deutsches Öl (DIE ZEIT, 15/2011)
Vor Friedrichskoog operiert die einzige deutsche Bohrinsel. Knapp 1,4 Millionen Tonnen Öl pumpten sie und ihre Landstation 2010 aus dem Grund unter dem Wattenmeer. Der Betreiber RWE Dea verdient gut daran – noch.
Erneuerbare Energien
Allgemeine Informationen
Erneuerbare Energien (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)
Auf dieser Seite finden Schüler umfassende Informationen zum Thema erneuerbare Energien: Was ist Solarenergie, was Windenergie? Welche Gesetze und Verordnungen gibt es zu ihrer Nutzung?
Unendlich viel Energie (Agentur für Erneuerbare Energien, AEE)
Die AEE stellt hier Informationen zu allen erneuerbaren Energieformen vor. Schüler erfahren auch, wie Wirtschaft und Politik mit dem Thema erneuerbare Energien umgehen.
Föderal erneuerbar (foederal-erneuerbar.de)
Eine interaktive Karte zeigt, wie weit die Bundesländer beim Ausbau der erneuerbaren Energien sind. Außerdem erfahren Schüler, wie es um Forschung, Unternehmen und Beschäftigung rund um die Zukunftstechnologien bestellt ist.
Erneuerbare Energien könnten das Weltklima erheblich besser schützen (WDR5, Podcast)
Im Interview erklärt Stefan Singer vom World Wide Fund for Nature (WWF) warum es sinnvoll ist, in erneuerbare Energien zu investieren.
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (Agentur für Erneuerbare Energien, AEE)
Im April 2000 ist das Gesetz über den Vorrang Erneuerbarer Energien (EEG) in Kraft getreten. Eine Grafik der AEE zeigt, wie viel Prozent Wasser, Wind und Sonne zuvor und seitdem zur Stromerzeugung beigetragen haben.
Wir machen alles selber (DIE ZEIT, Nr. 13/2011)
Vertreter des Landkreises Bamberg wollen ihre Region vollständig aus regionalen und erneuerbaren Energiequellen versorgen. Damit sind sie nicht allein. Sogenannte 100-Prozent-Projekte haben „gewaltig Fahrt aufgenommen“, sagt Bene Müller vom Bürgerunternehmen Solarcomplex, das im deutschen Südwesten schon das siebte Bioenergiedorf plant.
Solarenergie
Das Potenzial des Sonnenstroms (Planet Schule, Interaktive Grafik)
Wie ergiebig ist eine Solaranlage auf dem Dach? Wo wird sie befestigt? Und was hat die Neigung des Hausdachs mit der Effizienz zu tun? Antworten gibt diese virtuelle Konstruktion einer Photovoltaik-Anlage.
Solarstrom selber machen lohnt noch (ZEIT ONLINE, 25.07.2011)
Die Besitzer von Solaranlagen erhalten künftig weniger Förderung vom Staat. Wer erst 2011 seine Kollektoren auf dem Dach angemeldet hat, erhält statt 39 Cent je eingespeister Kilowattstunde nur noch 29 Cent. Trotzdem kann sich die Anschaffung rechnen.
„Den Ausbau bremsen“ (DIE ZEIT, Nr. 05/2011)
„Wenn der grüne Strom vollständig in Deutschland erzeugt werden soll, geht es ohne Photovoltaik nicht“, sagt der Flensburger Ökonom Olav Hohmeyer. Im Interview spricht er über Solarstrom und ökogerechte Versorgung.
Wann sich Solarenergie auf dem Dach lohnt (welt.de, 30.5.2009)
Wer eine Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren möchte, muss meist tief in die Tasche greifen. Da stellt sich die Frage, ob sich eine private Photovoltaikanlage lohnt. Das Dach spielt dabei eine große Rolle. In Osnabrück, Braunschweig und anderen Gemeinden sind deshalb die Dächer vermessen worden.
Konkurrenz aus Fernost überrollt deutsche Solarbranche (WirtschaftsWoche, 3.6.2011)
Ausgerechnet die deutsche Solarwirtschaft droht zum Verlierer der Energiewende zu werden. Denn fast jede zweite in Deutschland installierte Solaranlage kommt aus China.
Windenergie
Windkraft (hallingen.de)
Kurz und knapp erklären mehrere Poster, wie eine Windkraftanlage funktioniert. Außerdem erfahren Schüler mehr über das Für und Wider der Windenergie und über Offshore-Windparks.
Ein Mann namens Windmühle (ZEIT ONLINE, 03.08.2011)
Lange galt Johann-Georg Jaeger als Spinner. Aber er ließ nicht locker – und gilt heute als Pionier: Deutschland war erst ein paar Monate wiedervereinigt, als er seinen ersten Windpark plante.
Finanzinvestoren bauen jetzt Windparks (ZEIT ONLINE, 17.08.2011)
Auf der Suche nach attraktiven Renditen entdecken Finanzinvestoren Offshore-Windparks. Die Politik unterstützt ihr Engagement. Bürgerprojekte bleiben dabei auf der Strecke.
Made in Germany: Neue Entwicklungen in der Windkraft (Deutsche Welle TV, YouTube)
Im stürmischen Norden Deutschlands stehen zahlreiche Windräder. Im Inneren des Landes hingegen ist noch reichlich Platz, nur die Energieausbeute ist noch nicht ideal. Ingenieur Aloys Wobben zeigt Lösungsansätze für das Problem auf.
Grün gegen Grün im Hotzenwald (DIE ZEIT, Nr. 38/2010)
Bis 2050 soll unsere Elektrizität zu achtzig Prozent aus erneuerbaren Energien stammen. Um Windenergie zu fördern, soll ein neues Pumpspeicherkraftwerk im Südschwarzwald entstehen. Umweltschützer protestieren gegen den Bau. Die Grafik im Text zeigt, wie die Anlage funktioniert.
Wasserkraft
Wasserkraft im Überblick (unendlich-viel-energie.de, Video)
Aktuelle Fakten zur Wasserkraft in Deutschland
Wasserkraft für Kleinstandorte (spektrum.de)
In Deutschland gilt das Potenzial für Energie aus Wasserkraft als ausgeschöpft. Eine neue Technik soll nun auch Kleingewässer nutzbar machen, ohne Fischen zu schaden: mit einem fischfreundlichen Schachtkraftwerk.
Biogas
Biostrom, nein danke! (DIE ZEIT, Nr. 29/2011)
Die meisten Biogasanlagen belasten die Umwelt deutlich mehr, als sie ihr nutzen. Sie zerstören die Artenvielfalt, schädigen Gewässer und das Klima.
Biogas – Pflanzen Rohstoffe Produkte (Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe)
In dieser Publikation erfahren Schüler alles zum Thema Biogas. Woher kommt es und wie nutzen wir es als Energielieferant. Wie funktioniert eine Biogasanlage? Wie viel Biogas nutzen die Deutschen? Wie ist die Nutzung von Biogas rechtlich geregelt?
Erdwärme – Geothermie
„Seit 100 Jahren ohne schweres Unglück“ (ZEIT ONLINE, 13.11.2009)
Der Potsdamer Geowissenschaftler Ernst Huenges spricht über die Chancen und Risiken der Energie aus dem Untergrund.
Erschüttertes Vertrauen in Erdwärme (ZEIT ONLINE, Tagesspiegel, 02.10.2009)
Regelmäßig bebt die Erde wegen der Suche nach Wärme im Boden. Die Erdbohrungen verursachen oft Schäden in Millionenhöhe. Wie lässt sich das Risiko starker Beben verringern?
Gar nicht so öko (ZEIT ONLINE, 20.05.2009)
Was tun, wenn der steigende Ölpreis bald auch die Heizkosten in die Höhe treibt? Die Bundesregierung will die Wärmepumpe als erneuerbare Energie fördern. Doch die Ökobilanz der Erdwärme-Heizung ist umstritten.
Animation – Geothermie/Erdwärme (unendlich-viel-energie.de, Video)
Die Animation erklärt, wie Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren Energie zum Heizen erzeugen. Das Energiemanagement funktioniert vollautomatisch.
Erdgas
Are we entering a golden age of gas? (wordlenergyoutlook.org)
Der weltweite Gasverbrauch könnte in den nächsten 25 Jahren um mehr als die Hälfte steigen. Laut einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) von 2011 gibt es große Vorräte. Eine Grafik zeigt die weltweiten Förderquellen.
Atomenergie
Wie funktioniert ein Kernkraftwerk? (Planet Schule, Video)
Nur selten ist es möglich, in das Innere eines Atomkraftwerks zu blicken. Das Video zeigt das Herzstück einer Anlage, die Sicherheitsvorkehrungen und wie eine Uran-Kernspaltung funktioniert.
Grundkurs Radioaktivität (DIE ZEIT Nr. 13/2011)
Was im Atomreaktor passiert, warum Strahlung für uns gefährlich ist und wie man sich im Ernstfall schützen kann. Eine Infografik als Grundkurs über Radioaktivität.
Kernkraftwerke in Deutschland (Spiegel Online, Interaktive Grafik)
Alle Kraftwerke, die vor 1980 gebaut worden sind, hat die Bundesregierung abgeschaltet. Wie viele Reaktoren gibt es noch in der Republik? Die interaktive Grafik zeigt Standorte, die Bedrohung durch Erdbeben und erklärt, wie eine Kernspaltung abläuft.
Kerntechnisches Regelwerk (Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit)
Die rechtlichen Voraussetzungen für die friedliche Nutzung der Kernenergie schaffte in Deutschland das 1960 in Kraft getretene Atomgesetz. Was regelt es heute?
Wohin mit dem Atommüll?
Vom Salzbergwerk zum Atommülllager (ZEIT ONLINE, 08.03.2010)
Erst Bergwerk, dann Forschungslager und schließlich verseuchtes Atommüllgrab: Die Schachtanlage Asse ist zum Politikum geworden. Ein Blick in die Schachtanlage und den Stollen mit interaktiven 360-Grad-Panoramabildern.
Die strahlende Atomlast der Bundesrepublik (DIE ZEIT, Nr. 45/2010)
Regelmäßig rollen die Castor-Transporte durch Deutschland. Sie transportieren Behälter mit radioaktiven Abfällen zu den Zwischenlagern. Wo lagert wie viel radioaktiver Müll aus Kernkraftwerken und wie gefährlich ist er?
Murks im Stollen von Asse (DIE ZEIT, Nr. 31/2009)
Die Asse war einst ein Bergwerk. Heute lagern hier mehr als 100.000 Fässer Atommüll – ein umstrittenes Vorgehen. Die Infografik zeigt, wie der Stollen aussieht.
Geparkt und nicht abgeholt – Atommüll in Deutschland (Quarks&Co, YouTube)
Wohin mit schwach- und mittelradioaktivem Müll, 13.400 Tonnen hochradioaktivem Abfall, Schutzanzügen und Brennstäben? Ein Video über das Lagerproblem von Atommüll.
Der Fall Fukushima
Kernschmelze in Fukushima (DIE ZEIT, Nr. 12/2011)
Das Erdbeben und der Tsunami zerstörten in Japan die drei alten Reaktoren am Kraftwerksstandort Fukushima-1. Die Kühlung versagte, die strahlenden Brennstäbe begannen zu schmelzen. Die Infografik zeigt, was im Inneren der Reaktoren passierte.
Aktueller Status der Fukushima-Reaktoren (spiegel.de)
Wie stark sind die Reaktoren geschädigt? Wie hoch ist der Druck im Reaktor? Können Arbeiter die Anlage betreten? Eine Flash-Grafik zeigt die Zustände der Reaktoren am 6.7.2011.
Von Super-GAU bis glimpflich ist alles möglich (ZEIT ONLINE, 18.03.2011)
Fallout über Tokyo oder begrenzter Unfall? Niemand weiß, wie es im AKW Fukushima weitergeht. Sven Stockrahm beschreibt das beste und das schlimmste denkbare Szenario.
Chronologie der Katastrophe in Fukushima I (Daiichi) (spiegel.de)
Die interaktive Grafik zeigt anhand von Fotos die Chronologie der Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima von der ersten Explosion bis zum Verbot von Lebensmittellieferungen.
Klimawandel
Klimaseite der Max-Planck-Gesellschaft (MPG) (atmosphere.mpg.de)
Was ist die untere Atmosphäre? Welche Gründe gibt es für den Klimawandel? Was ist der Treibhauseffekt? Die Klimaenzyklopädie der MPG gibt Antworten. Schüler bekommen einen Überblick über das Klimasystem, Forschungsmethoden und deren Unsicherheiten und den menschlichen Einfluss auf das Klima.
Was die Erde warm macht (Quarks & Co, Video)
Was macht unseren Planeten bewohnbar? Und wie hoch ist die “globale Mitteltemperatur“?
Gewinner und Verlierer des Klimawandels (WDR, Fotostrecke)
Eine Studie des NRW-Umweltministeriums geht davon aus, dass bis 2055 die mittlere Jahrestemperatur in Nordrhein-Westfalen um ein bis zweieinhalb Grad Celsius steigen wird. Wie sich das auf die heimische Tier- und Pflanzenwelt auswirken würde, zeigt diese Fotostrecke.
Arctic Melt Unnerves the Experts (New York Times, 2.10.2007)
Das Eis in der Arktis schmilzt. Verantwortlich für den Trend sei das Zusammenspiel von Wind, Wetter, Eisdrift, Meeresströmungen und Treibhausgasen, sagen Experten der Universität Alaska. Eine Grafik zeigt die Veränderungen von 2003 bis 2007.
Weltklimarat (IPCC)
Was ist das IPCC? (mpimet.mpg.de)
IPCC steht für Intergovernmental Panel on Climate Change, im Deutschen auch Weltklimarat genannt. Er wurde 1988 durch die Weltorganisation für Meteorologie und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (Unep) gegründet. Was sind seine Aufgaben? Zu welchen Forschungsergebnissen über das Klima ist der Rat gekommen?
Die graue Weste des IPCC (FOCUS Magazin, 6/2010)
Der Klimaforscher Hans von Storch beschreibt in seinem Essay, warum der Weltklimarat an Glaubwürdigkeit verlor – und wie er aus der Krise herauskommen könnte.
Der menschengemachte Klimawandel ist keine Verschwörung (Tagesspiegel, 4.12.2009)
Das Jahr 2009 war für den Weltklimarat eine Katastrophe. Skeptiker des Klimawandels fühlten sich durch gehackte E-Mails des Forschers Phil Jones bestätigt. Dennoch sind die Indizien für einen menschlichen Einfluss auf das Klima erdrückend, der Klimawandel ist real.