Stuart Staples ist Sänger der Großstadt-Melancholiker Tindersticks. Mit seinem zweiten Solalbum „Leaving Songs“ knüpft er an das Frühwerk der englischen Band an
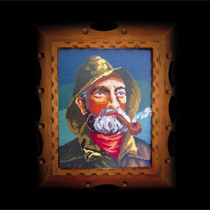
Topfpflanzen, wohin das Auge reicht. Kleine, große, karge, dünne. Farne auf Tellern, Gummibäume in Töpfen, Aloe Vera vor einer rosa angehauchten Zimmerwand. Man kann sich vorstellen, wie sie vom charakteristischen Tremolo des Sängers Stuart Staples in Schwingung geraten, wie ihre Blätter beim Musikhören zittern.
Als der 1965 geborene Musiker aus Nottingham im vergangenen Jahr sein erstes Soloalbum veröffentlichte, hatte das bereits etwas von einem Abgesang auf die opulent orchestrierten Stücke seiner Band. Von Trennung wollte trotzdem niemand reden. Lucky Dog Recordings 03-04 klang wie ein Gegenentwurf zu den Tindersticks: minimalistisch, karg, solitär. Zur Untermalung seiner Texte verzichtete er auf Streicherekstase, eine alte Orgel reichte ihm in seinem kleinen Studio. Das CD-Booklet mit den botanischen Einblicken passte prächtig, zusammen mit Frau Suzanne hatte Staples seine Hauspflanzen ins rechte Licht gerückt. Nur knapp ein Jahr danach folgt nun Solostreich Nummer zwei. Eingespielt worden ist Leaving Songs in Nashville, zusammen mit Lambchop-Produzent Mark Nevers, der zuvor schon Bonnie ‚Prince‘ Billy und Calexico ins Studio begleitete.
Staples macht einen Schritt zurück und einen zur Seite. Er erfindet sich solo nicht neu, sein Kosmos bleibt vertraut. Den Minimalismus der Lucky Dog Recordings hat er in Amerika an der Studiogarderobe abgegeben. Leaving Songs klingt wie eine Rückkehr in die Frühphase der Tindersticks, gepaart mit amerikanischem Liedgut. Große Gefühle packt er in fein inszenierte fünfminütige Pop-Dramen. Wer die Tindersticks nie mochte, für den klingt auch dieses Album nach romantisch-verklärter Rotwein-Musik.
Verflossene Beziehungen, Trennungen und die Unwägbarkeiten des Lebens stellen das narrative Arsenal. Der Titel Leaving Songs ist nicht zufällig gewählt: So viel Abschied war nie. Das Schlagzeug wird dazu zärtlich gestreichelt, das Piano liefert im Verbund mit der akustischen Gitarre Melodien, die im Kopf bleiben. Zwischendurch farbtupfern die Trompeten. Die Lieder stehen und fallen mit Staples Stimme. Man erkennt sie aus Tausenden. Ein in rauchigen Holzfässern gereiftes Timbre weist den Weg. Zwei Mal ergänzen weibliche Stimmen die Lieder zwischen Country-Ballade und Trauer-Pop. Auf Maria McKee hätte verzichtet werden können. Das Duett mit Lhasa de Sela gelingt überzeugender: That Leaving Feeling rauscht im Kindereisenbahnwaggon durch eine alte und eine neue Beziehung.
Leaving Songs ist ein schönes, wenn auch erwartbares Album geworden. An der Prägnanz des Band-Meisterwerks Curtains darf man es nicht messen. Staples hat seinen Frieden mit der Vergangenheit gemacht. Auf Konzerten lächelt er neuerdings des Öfteren. Trauersongs machen glücklich.
„Leaving Songs“ von Stuart Staples ist als LP und CD erschienen bei Beggars Banquet.
Sehen Sie hier ![]() „That Leaving Feeling“
„That Leaving Feeling“
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie POP
Nelly Furtado: „Loose“ (Geffen/Universal 2006)
Justine Electra: „Soft Rock“ (City Slang 2006)
Nouvelle Vague: „Bande À Part“ (PIAS 2006)
The Superimposers: „Missing“ (Little League Productions 2006)
Pet Shop Boys: „Fundamental“ (EMI/Capitol 2006)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik








