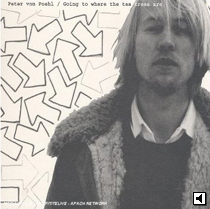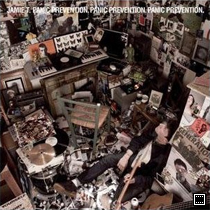Die Fehlfarben – zu jung zum Sterben und zu alt für den Punkrock. Als jugendliche Rebellen gehen sie auf ihrem neuen Album „Handbuch für die Welt“ nicht mehr durch
Dieses Mal zählts. Als vor fünf Jahren die alten Herren des deutschen Punk nach vieljährigem Hobbymusikerdasein wieder die Gitarren umschnallten, war noch nicht ganz sicher, wohin die Reise gehen sollte. Zurück in die Vergangenheit oder mitten hinein ins Hier und Jetzt? Ein Aufenthalt auf Dauer oder doch nur der Versuch, kurzfristig in Jugendzeiten versäumte Rendite einzuspielen, um das Rentnerdasein finanziell ein wenig abzufedern? Knietief im Dispo war die Mission überschrieben: ein augenzwinkernder Seitenhieb auf all die geschmäcklerischen Rückkehrversuche, von denen das Popgeschäft im Zeichen der eigenen Wiederkehr seit je wimmelt. Bis dahin war die Band Fehlfarben ein deutscher Punk-, wenn nicht Popmythos, der auf immer mit dem Jahre 1980 verbunden sein sollte. Ihr Revoluzzer-Monument Monarchie und Alltag bildete für viele ihrer damaligen Hörer, also die heutigen Mitt- und Endvierziger, die Tonspur ihrer Jugend. In den Texten von Peter Hein fand zusammen, was einmal zusammengehörte: bundesrepublikanische Alltagsbeobachtungen und jugendliches Rebellentum, Punk und Politik.
Fast mag das heute ein wenig anachronistisch anmuten, in Zeiten, in denen der Revoltenchic vergangener Tage längst zum Marktsegment verkommen ist und auf Privatsendern in Achtziger-Jahre-Mottoshows auch die Fehlfarben ihre 60 Sekunden Ruhm ernten dürfen kommentiert von den einstigen Klassenfeinden. Geschichte wird gemacht so oder so, auch wenns musikalisch längst nur noch an anderer Stelle vorangeht. Volle Kraft voraus, Viervierteltakt, Punkrock? War da was?
Vom Mythos der jugendlich ungestümen Rebellen sind die Fehlfarben heute so weit entfernt wie nur denkbar. Ihr Verdienst um die deutschsprachige Musik ist unbestritten. Trist ist allenfalls die Gegenwart: Ein paar ergraute Herren proben noch einmal den Aufstand und schwingen das Schwert der gesellschaftlichen Fundamentalkritik. Unerbittlich im Gestus, rückwärtsgewandt in den ästhetischen Mitteln. Neu, frisch und unverblümt klingt auf dem aktuellen Album Handbuch für die Welt wenig. Die, die sich Ende der Siebziger aufmachten, den Altherrenrock von der Bühne zu fegen, sind selbst zu einer Altherrenband geworden. „Ja, wir sind anders, anders geblieben“, grummelt Peter Hein im Eröffnungsstück des Albums, als gelte es, mit aller gebotenen Schärfe noch einmal den neuen, alten politischen Standort zu bestimmen. Nur: Die Zeiten haben sich gewandelt. So sehr die Fehlfarben in den Achtzigern in ihre Zeit passten und diese widerspiegelten, so weit sind sie heute von allen gesellschaftlichen und musikalischen Strömungen entfernt.
Wehe dem, der am eigenen Mythos kratzt. Zu jung zum Sterben und zu alt für den Punkrock: Es ist das Malheur aller zu früh Geborenen, die Helden waren, als sie das selbst noch nicht wussten. Ironischerweise gelingt den Fehlfarben des Jahres 2007 mit dem einzigen wirklich alten Stück, einer Coverversion der singenden GIs The Monks (We Do Wie Du), ihre zeitgenössischste Ausformulierung. Für einen Moment weicht alles Bedeutungsschwangere aus den Zeilen, aller bleierne Schwulst aus den Arrangements. „We do as you, we do, we do, wie du, wie du.“ Du, das heißt bei den Fehlfarben wohl „wir“, Humor lugt durch die Zeilen. Nichts gibts umsonst: keinen Mythos und keine Wiederkehr. Der Rest ist Geschichte.
Hören Sie hier ![]() „Anders geblieben“
„Anders geblieben“
„Handbuch für die Welt“ von den Fehlfarben erscheint am 20. April bei V2 Records
…
Weitere Beiträge aus der Kategorie ROCK
Maximo Park: „Our Earthly Pleasures“ (Warp 2007)
!!!: „Myth Takes“ (Warp/Rough Trade 2007)
The Fall: „Reformation! Post-TLC“ (Slogan/Sanctuary 2007)
Arcade Fire: „Neon Bible“ (City Slang 2007)
Kaiser Chiefs: „Yours Truly, Angry Mob“ (B-Unique/Universal 2007)
Alle Musikangebote von ZEIT online finden Sie unter www.zeit.de/musik