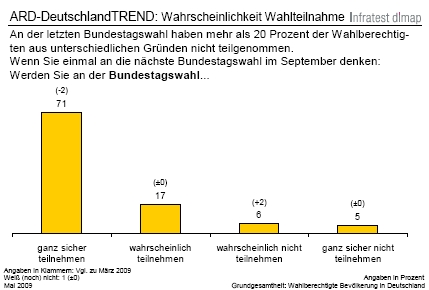Die Sitzordnung entwickelt sich zum Leitmotiv: Sowohl beim TV-Duell zur Europawahl (ausgestrahlt am Sonntagmittag auf ARD) als auch im europapolitischen Townhall-Meeting „Jetzt reden wir“ (Montagabend, ebenfalls ARD) saßen die jeweils sechs Kandidaten dicht gedrängt in einer Reihe nebeneinander. Konfrontative Anordnungen, in denen die Politiker einander anschauen und direkte Gespräche führen, waren nicht angesagt.
Die Sitzordnung entwickelt sich zum Leitmotiv: Sowohl beim TV-Duell zur Europawahl (ausgestrahlt am Sonntagmittag auf ARD) als auch im europapolitischen Townhall-Meeting „Jetzt reden wir“ (Montagabend, ebenfalls ARD) saßen die jeweils sechs Kandidaten dicht gedrängt in einer Reihe nebeneinander. Konfrontative Anordnungen, in denen die Politiker einander anschauen und direkte Gespräche führen, waren nicht angesagt.
Und tatsächlich konnte man bisweilen den Eindruck bekommen, dass die anwesenden Vertreter der Parteien in beiden Sendungen eher gemeinsam das europäische Projekt verteidigten, anstatt über konkrete Inhalte zu streiten. Echte Kontroversen entstanden zudem meist bei jenen Themen, die auch in der nationalen Politik auf der Agenda stehen: Die Bewältigung der Wirtschaftskrise, die Arbeitsmarktpolitik, die Bildungspolitik und auch grüne Themen haben natürlich große europäische Bezüge und kein einziges dieser Politikfelder kann rein national bearbeitet werden. Die Argumente der anwesenden Politiker hierzu waren jedoch annähernd identisch mit denen, die wir auch im Bundestagswahlkampf hören werden; explizit europäische Lösungsansätze waren häufig nicht erkennbar.
Allerdings fanden auch einige originär europäische Themen in den beiden Sendungen Platz. Die Spitzenkandidaten diskutierten beispielsweise im TV-Duell die Frage des EU-Beitritts der Türkei (freilich ohne neue Argumente zu bringen) und im Townhall-Meeting waren mit der Agrarpolitik und dem Verbraucherschutz zwei Themen ganz oben auf der Tagesordnung, die mittlerweile zu den europäischen Kernkompetenzen zählen dürfen. Alles in allem hat die ARD den Zuschauern also in kurzer Folge zwei moderne TV-Formate zur Europawahl geboten und so der Forderung nach mehr Medienpräsenz für europapolitische Themen Rechnung getragen, die auch Autoren und Leser dieses Blogs schon geäußert hatten.
Wie viele Zuschauer haben sich nun tatsächlich für diese Sendungen interessiert? Bezüglich des TV-Duells fällt eine faire Einschätzung schwer, da als Vergleichsgrößen nur die Debatten anlässlich der Bundestagswahlen in Frage kommen (Gerhard Schröder gegen Edmund Stoiber 2002 und Angela Merkel gegen Gerhard Schröder 2005). Denn die Zielgruppe der anderen TV-Duelle (beispielsweise anlässlich der Landtagswahlen in Bayern, Brandenburg, Hessen und Niedersachsen) war nicht die Gesamtbevölkerung. Die erwähnten Duelle zu den Bundestagswahlen hatten andererseits durch prominentere Sendeplätze und größere Medienpräsenz im Vorfeld der Sendungen gewichtige Startvorteile gegenüber dem am Sonntag ausgestrahlten Streitgespräch. Die Einschaltquoten sprechen trotz all dieser Einschränkungen eine deutliche Sprache: Gerade einmal 0,57 Mio. Zuschauer verfolgten die Debatte am Sonntag, ein Marktanteil von 5,5 Prozent. Das TV-Duell zur Bundestagswahl 2005 verfolgten 21 Mio. Menschen bzw. 59,8 Prozent.

Für das Zuschauerinteresse an der Sendung „Jetzt reden wir“ ist das Townhall-Meeting mit Angela Merkel eine Woche zuvor auf RTL ein guter, aktueller Maßstab; das Format war ähnlich
Dies ist schade, weil beide Formate – das TV-Duell und „Jetzt reden wir“ – durchaus die europäische Idee transportiert haben. Wer sich auf die Sendungen eingelassen hat, konnte ein echtes europäisches Wir-Gefühl entwickeln. Berichte aus Grenzregionen, in denen längst keine Grenzen mehr existieren, und eigens komponierte Europahymnen haben ein bleibendes europäisches Zusammengehörigkeitsgefühl vermittelt. Diese etwas abstrakte Frage der gemeinsamen europäischen Identität wird leider meist nur am Rande diskutiert, obwohl es zumindest in wissenschaftlichen Kontexten, auf spezifisch europapolitischen Portalen oder mitunter auch in der „Blogosphäre“ entsprechende Impulse gibt. Dieser Befund ist jedoch auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass es an Foren für einen solchen Austausch – die eine gemeinsame europäische Öffentlichkeit bilden könnten – auf allen Ebenen mangelt.
Formate wie das TV-Duell und das Townhall-Meeting zur Europawahl könnten dazu beitragen, diese Gedanken auf die Straße zu bringen. Vielleicht muss man solche Sendungen schlicht und ergreifend noch viel öfter anbieten…
 Nun ist es also soweit. Das große „TV-Duell„ zwischen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier findet am 13.9., zwei Wochen vor der Wahl, statt. Die 90-minütige Debatte wird ab 20:30 von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 übertragen. Jeder Sender stellt auch einen Moderator als Fragesteller. Ist das nun das von Reinhard Appel 1972 vielbeschworene „mehr Demokratie“ oder soll es in erster Linie der Politunterhaltung und dem Interesse der Fernsehsender dienen? Dass die kleinen Parteien ausgeschlossen sind und somit eine Möglichkeit weniger haben, flächendeckend die eigenen Wähler mit guter Rhetorik zu mobilisieren, wurde prompt von Guido Westerwelle (FDP) moniert. Er kritisierte, dass „die Opposition, die etwa 35 bis 40 Prozent der Stimmen in den Umfragen auf sich vereint, ausgesperrt wird“. Und recht hat er.
Nun ist es also soweit. Das große „TV-Duell„ zwischen Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier findet am 13.9., zwei Wochen vor der Wahl, statt. Die 90-minütige Debatte wird ab 20:30 von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 übertragen. Jeder Sender stellt auch einen Moderator als Fragesteller. Ist das nun das von Reinhard Appel 1972 vielbeschworene „mehr Demokratie“ oder soll es in erster Linie der Politunterhaltung und dem Interesse der Fernsehsender dienen? Dass die kleinen Parteien ausgeschlossen sind und somit eine Möglichkeit weniger haben, flächendeckend die eigenen Wähler mit guter Rhetorik zu mobilisieren, wurde prompt von Guido Westerwelle (FDP) moniert. Er kritisierte, dass „die Opposition, die etwa 35 bis 40 Prozent der Stimmen in den Umfragen auf sich vereint, ausgesperrt wird“. Und recht hat er.