So, jetzt kann die Fed die Zinsen nicht weiter senken. Seit Dienstag liegt die Zielmarke für die Fed Funds Rate im Bereich der Null Prozent Grenze. Wie Ben Bernanke am 1. Dezember in einer Rede noch einmal klarstellte, ist die Fed dadurch aber keineswegs mit ihrem Latein am Ende. Jetzt wird die Wirtschaft mit Liquidität überschwemmt, und es wäre ja gelacht, wenn es nicht gelingen würde, die Kaufkraft des Greenbacks wieder zu vermindern. Denn darum geht es: Deflation zu vermeiden, und möglichst rasch zu einer Inflationsrate von etwa 2 Prozent zurückzukehren, also zu einer jährlichen Entwertung des Geldes in dieser Größenordnung, was nach dem aktuellen Verständnis der führenden Notenbanken als Preisstabilität gilt.
Deflation ist schlimm, wie wir wissen. Ein unerwünschter Effekt besteht darin, dass die Geldpolitik nicht mehr in der Lage ist, die kurzfristigen Realzinsen zu senken. In einer Situation wie heute sind sehr niedrige oder sogar negative Realzinsen das Gebot der Stunde. Angenommen die Inflationsrate beträgt minus 2 Prozent, dann bedeutet das für den realen Notenbankzins plus 2 Prozent, wenn er nominale Satz, so wie heute, 0 Prozent beträgt. Sinkt die Inflationsrate weiter, beispielsweise auf minus 4 Prozent, steigt der Realzins auf plus 4 Prozent. In einer tiefen Rezession ist das tödlich. Ist die Nullgrenze einmal erreicht, ist das Zinsinstrument in deflationären Zeiten wirkungslos, also dann, wenn es besonders dringend gebraucht wird.
Dass die Zeichen auf Deflation stehen, zeigt die Renditedifferenz zwischen nominalen und inflations-indizierten US Treasuries. Sie ist ein Maß für die Inflationserwartungen der Investoren am Markt für US-Staatsanleihen. Auf Sicht von fünf Jahren sind sie deutlich negativ, auf Sicht von zehn Jahren nahe null.
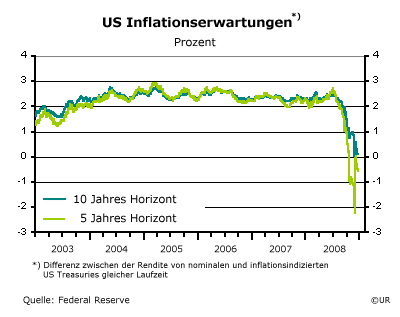
Wie sieht es aktuell mit der US-Inflation aus? Zwischen Juli und November sind die Verbraucherpreise saisonbereinigt um 2,8 Prozent gefallen. Rechnet man das hoch auf zwölf Monate, ergibt sich eine sogenannte Verlaufsrate von minus 8,6 Prozent. Deflation ist also nichts, was irgendwann in der Zukunft passieren könnte, sie ist bereits da. Die amerikanische Kerninflation ist allerdings noch nicht im negativen Bereich angelangt – hier ist der Preisindex aber immerhin seit Juli de facto konstant und es wird zunehmend wahrscheinlicher, dass auch er bald sinken wird. Dafür spricht unter anderem, dass die amerikanischen Erzeugerpreise im selben Zeitraum saisonbereinigt um 6,15 Prozent gefallen sind, was einer Jahresrate von 19,6 Prozent entspricht. Neunzehnkommasechs! In der Pipeline steckt also noch eine Menge an Deflation und es ist verständlich, dass die Fed angesichts dieser Zahlen äußerst nervös ist.
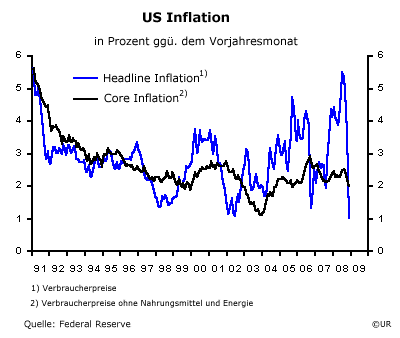
Das andere große Problem mit der Deflation ist ihre Wirkung auf die Schuldenlast von Haushalten und Unternehmen. Darauf hat insbesondere der amerikanische Ökonom Irving Fisher in den dreißiger Jahren hingewiesen. Wenn sich jemand 1000 Dollar geliehen hat, die er in zehn Jahren zurückzuzahlen hat, steigt der Betrag real umso mehr, je stärker das Preisniveau in diesem Zeitraum sinkt. Angenommen, die durchschnittliche jährliche Inflationsrate sei minus 1,5 Prozent, dann erhöht sich die reale Schuldenlast um 16,05 Prozent. Deflation begünstigt den Gläubiger und veranlasst andererseits den Schuldner, das geliehene Geld möglichst rasch zurückzuzahlen, also forciert zu sparen. In einer Wirtschaftskrise ist das aber genau das Gegenteil dessen was notwendig ist.
In einer Deflation steigt natürlich auch die reale Schuldenlast des Staates und des Landes insgesamt. Da die USA jahrzehntelang Leistungsbilanzdefizite aufwiesen, also netto Kapital importierten, ist das Ausland ein großer Nettogläubiger gegenüber der US-Volkswirtschaft. Es ist daher im amerikanischen Interesse, diese Schulden wegzuinflationieren, also im Zuge des Schuldendienstes letztlich möglichst wenig an Gütern und Dienstleistungen an das Ausland zu übertragen oder aufzugeben. Das ist leichter gesagt als getan. Eine Inflation lässt sich vielleicht hinbekommen, das hätte aber vermutlich zur Folge, dass der Dollar sowohl nominal als auch real abwertet, womit sich die Terms of Trade verschlechtern würden – für eine Einheit an Importen müsste mehr exportiert werden, was wiederum eine Einbuße an Realeinkommen mit sich bringt. Am besten wäre aus Sicht des Schuldners USA ein kräftiger Anstieg des Preisniveaus und eine reale Aufwertung des Dollars. Ich vermute, dass die Ausländer keine Lust mehr haben, weiterhin Dollarassets anzusammeln, also durch Interventionen den Dollarkurs zu stützen.
Die Fed ist inzwischen bekanntlich auf neues Territorium vorgestoßen, Stichwort „quantitative easing“. Ben Bernanke hat das den zweiten Pfeil im Köcher der Notenbank genannt. Auf der Home Page der Fed findet sich eine lange Liste der Maßnahmen, die sie seit Dezember 2007 auf den Weg gebracht hat. Da die Notenbank unbegrenzt Dollar in Umlauf setzen kann, kann sie auch, wenn sie die längerfristigen Konsequenzen nicht fürchtet, den Wert des Dollar so stark senken wie sie es für richtig hält. Sie erreicht das, indem sie alle Arten von Aktiva kauft, vom Schuldner Staat oder direkt im Markt. Sie verlängert damit ihre Bilanz und erhöht so das Angebot an Zentralbankgeld. Das ist bereits deutlich erkennbar: Von Jahresanfang bis zum 10. Dezember ist die Bilanzsumme von 944Mrd. Dollar auf 2.294Mrd. Dollar geradezu explodiert. Zum „quantitative easing“ kommt ein „qualitative easing“, indem die Fed auch Aktiva ankauft, die sie früher nicht angerührt hätte. Dazu zählen Term Auction Credits (448Mrd. Dollar), Kredite an Primary Dealers (53Mrd. Dollar), Kredite an den geretteten Versicherer AIG (57Mrd. Dollar), Commercial Paper, also kurzfristige Schuldverschreibungen des Unternehmenssektors (309Mrd. Dollar) und „andere Fed-Assets“, die innerhalb dieses Jahres von 67Mrd. Dollar auf 628Mrd. Dollar zugenommen haben.
Indem die Fed jetzt auch in großem Stil Anleihen der verstaatlichten Hypothekenbanken Freddie Mac und Fannie Mae aufkauft, übt sie einen direkten Einfluss auf die langen Zinsen aus und trägt mit dazu bei, dass der Hypothekenmarkt wieder in Gang kommt. Noch ist davon allerdings nichts zu sehen. Der Immobilienmarkt ist immer noch im freien Fall. Die sogenannten Housing Starts (Baubeginn von Wohnimmobilien) haben im November einen historischen Tiefpunkt erreicht und die Zahl der Verkäufe von neuen Wohnimmobilien war im Oktober so niedrig wie zuletzt Anfang der neunziger Jahre.
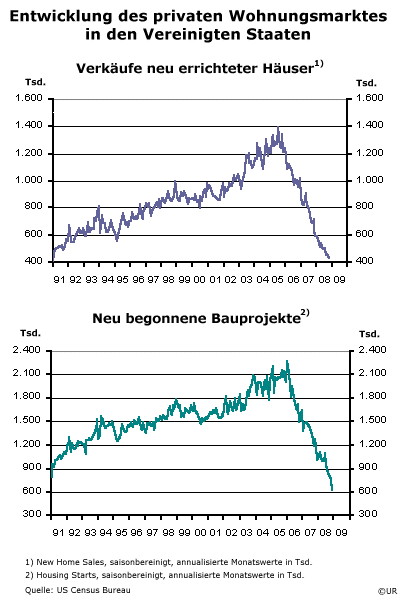
Übrigens könnte die Fed am Devisenmarkt auch Euro und Yen kaufen und auf diese Weise Dollars in den Markt schleusen. Auch das würde sich in einer Verlängerung ihrer Bilanz niederschlagen. Die anderen Notenbanken wären allerdings „hardly amused“ über eine solche Taktik – sie könnten das als Startschuss für einen Abwertungswettlauf betrachten.
Die Fed ist zur Zeit nicht nur Notenbank, sie agiert auch zunehmend wie eine private Geschäftsbank. Sie könnte schon bald der größte Kreditgeber des Landes sein und die privaten Banken ersetzen. Wenn es so weitergeht, wird es zwar nicht zu einer Verstaatlichung des Bankensektors kommen, aber immerhin zu einem staatlichen Bankenmonopol als Folge des (unfreiwilligen) Vorstoßes der Fed in die Lücken, die der private Sektor nicht mehr füllen will oder kann. Wer wird dann eigentlich die Fed beaufsichtigen?
Insgesamt hat der Kampf gegen die Deflation eine Dollarschwemme ausgelöst. Bernanke ähnelt dabei dem Zauberlehrling in Goethes Gedicht. Wir wissen, wie das dort endete: Die Geister, die er gerufen hatte, ließen sich nicht mehr bändigen. Während im Gedicht der Zaubermeister gerade noch rechtzeitig zurückkommt und mit dem richtigen Spruch die Katastrophe abwenden kann, habe ich meine Zweifel, ob das diesmal auch so einfach sein wird. Wenn der Dollar mit aller Kraft wertlos gemacht wird, wer will ihn dann noch haben? Die Märkte haben da offenbar auch ihre Zweifel. Es sieht so aus, als ob der Euro bald zwei Dollar kosten würde.
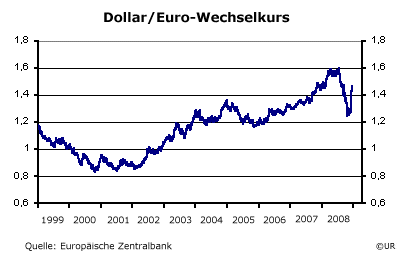
Die Briten befinden sich übrigens auf derselben Schiene wie die Amerikaner. Nach Meinung der Londoner Analysten sind Null-Zinsen nur eine Frage der Zeit. Der Wechselkurs des Pfundes bewegt sich daher rapide auf die Parität zum Euro hin. Gegenüber September 2007 errechnet sich daraus eine Euro-Aufwertung von 50 Prozent.
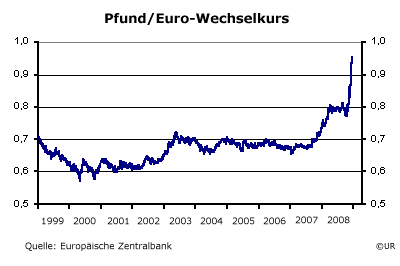
Man darf gespannt sein, wie die EZB auf diese Art von Politik reagieren wird. Wird sie sich auf den Abwertungswettlauf einlassen? Ich hoffe nicht. Nicht jede Notenbank sollte auf eine Entwertung des Kunstgeldes („fiat money“) setzen. In Europa muss die Finanzpolitik die Hauptlast der Stabilisierung tragen, was allerdings heißt, dass sie ganz andere Größenordnungen als bisher ins Auge fassen muss.