Ist eigentlich jemandem aufgefallen, dass Gelddrucken, die Monetarisierung staatlicher Schuldverschreibungen durch die Notenbank, also die Finanzierung der Staatsausgaben durch die Notenpresse, unter Ökonomen inzwischen ganz entspannt gesehen wird, schon fast als de rigueur gilt. Auch Martin Wolf hat am Mittwoch in der Financial Times eine Lanze für weiteres Gelddrucken gebrochen – und an den deutschen, amerikanischen und japanischen Rentenmärkten wird das offenbar ebenfalls begrüßt. Jedenfalls sinken die Renditen trotz dieser Sündenfälle weiter. Disinflation oder sogar Deflation können also einhergehen mit Gelddrucken. Bei 30-jährigen Bundesanleihen geben sich die Anleger zur Zeit mit einer jährlichen Rendite von 3,36 Prozent zufrieden. Was ist los mit ihnen? Warum kaufen sie gleichzeitig alle Goldmünzen, deren sie habhaft werden können?
Trotz des Konjunkturaufschwungs, der inzwischen in sein zweites Jahr geht, ist das Deflationsrisiko in den Industrieländern weiter gestiegen. Das ist nahezu Konsens unter Ökonomen, wenn vielleicht auch noch nicht in Deutschland, ebenso wie es Konsens ist, dass Inflation bald das Hauptproblem der Schwellenländer sein wird. Aggregiert ist die Kerninflationsrate in den USA, Euroland und Japan von 4,2 Prozent vor 20 Jahren ziemlich stetig auf zuletzt 0,5 Prozent gesunken. Hierbei handelt es sich um Vorjahresvergleiche: Die sogenannte Verlaufsrate ist bereits bei Null angekommen. Da die Kerninflation den Takt für die unbereinigte Inflation der Verbraucherpreise vorgibt, ist es keine Kaffeesatzleserei mehr, wenn ich vorhersage, dass das allgemeine Preisniveau demnächst wieder sinken wird.
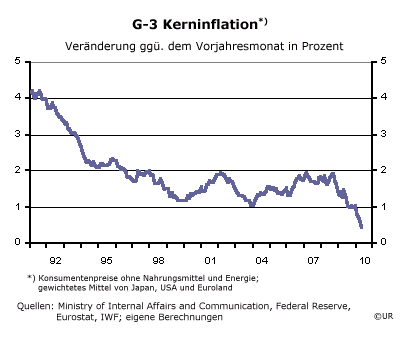
Deflation ist natürlich toll für alle, die über Bargeld und anderes Geldvermögen oder über feste Nominaleinkünfte aus Altersrenten und sicheren Anleihen verfügen. Der Wert des Geldes steigt ja! Normalerweise werden die Sparer und anderen Gläubiger im Laufe der Zeit de facto enteignet, während die Schuldner gewinnen. Diese Erfahrung ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert. Bei Deflation ist es aber umgekehrt: Da gewinnen die Gläubiger und die Rentner. In den Rentnerrepubliken der OECD wird das womöglich zunehmend als eine positive Entwicklung betrachtet. Warum soll die Kaufkraft des Geldes nicht auch mal steigen? Es gäbe damit auf Bargeld einen positiven Realzins. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Milton Friedman irgendwann mal gut und erstrebenswert gefunden.
Auf der (bislang erfolglosen) Suche nach dem Friedman Zitat bin ich auf ein Arbeitspapier von Bordo und Filardo gestoßen („Deflation in a historical perspective„, BIS 2005), in dem die Autoren auf Seite 26 zu der folgenden Schlussfolgerung kommen: „To an observer looking at the long history, current concerns about deflation may seem to be somewhat overblown. It is abundantly clear that deflation need not be associated with recessions, depressions, crises and other unpleasant conditions. The historical record is replete with good deflations. …“
„… There are, of course, plenty of bad deflations too.“ Denn Deflation hat bekanntlich zwei unerwünschte Nebeneffekte: Wenn das Auto, das ich kaufen möchte, morgen voraussichtlich billiger zu haben sein wird, lohnt es sich zu warten. Konjunkturell ist das meist schädlich: Es dämpft die Nachfrage und verstärkt den Attentismus. Die Realzinsen, der Lohn für das Warten, nehmen zu. Hinzu kommt Irving Fishers „debt deflation„: Die Hypothekenschulden oder die Verbindlichkeiten aus Festzinskrediten und Anleihen bleiben nominal immer gleich, die Einkommen und Gewinne, aus denen sie bedient werden, sinken aber meist im Verlauf einer Deflation, die reale Schuldenlast steigt also und erhöht damit das Konkursrisiko und den Zwang zum Sparen.
Zum letzten Punkt: Ich habe gerade zufällig in einer Publikation der Deutschen Finanzagentur gesehen, dass der Barwert (present value) der Bundesschuld von Juli 2008 bis vergangenen Monat um ca. 168 Mrd. Euro zugenommen hat, während ihr Nominalwert „nur“ um ca. 54 Mrd. Euro gestiegen ist (Investor Forum Juni 2010, S. 3). Der Grund war der starke Rückgang der Zinsen in dieser Zeit, und zwar über die gesamte Renditekurve hinweg. Für diesen Effekt reicht bereits eine Disinflation – wenn es tatsächlich zu einer Deflation kommen sollte, gibt es noch einmal eins oben drauf. Der Schuldner „Bund“, und damit die Steuerzahler, müssen real mehr an die Eigentümer der Staatsanleihen übertragen als sie es sich vermutlich vorgestellt hatten.
Ein weiterer problematischer Effekt besteht darin, dass die Notenbanken zwar gelernt haben, wie sich Inflation bekämpfen lässt, für den entgegengesetzten Fall fehlen ihnen jedoch weitgehend die Instrumente und Strategien.
Am 4. Juni hatte ich im Global Data Watch von J.P.Morgan einen spannenden Beitrag zum Thema Deflationsbekämpfung gelesen: Es reicht nicht, wenn die Notenbank in großem Stil staatliche Anleihen ankauft. Dadurch ändert sich lediglich der Liquiditätsgrad des nominalen Vermögens, nicht aber sein Wert. Statt Bonds hält das Publikum dann einfach Bargeld und Bankeinlagen, das Volumen an Finanzaktiva ist jedoch gleich geblieben.
Oder anders: Wenn die Notenbank ohne den Umweg über den Markt Bundesanleihen oder Treasuries in ihre Bücher nimmt, erhält der Staat im Gegenzug eine Gutschrift auf seinem Zentralbankkonto. Ceteris paribus verlängert sich dadurch die Bilanz des Eurosystems oder des Federal Reserve Systems. Das ist nicht anders als bei den wöchentlichen Repogeschäften oder beim Ankauf von Dollars gegen Eurogutschriften. Die sogenannte Geldbasis nimmt zu, die Bilanzsumme der Notenbank verlängert sich. Der Staat und die Banken erhalten liquide Mittel, die sie für Ausgaben verwenden können, die Notenbank dagegen verfügt über mehr Aktiva als zuvor. Ihre Aktiva (oder Forderungen) sind die Verbindlichkeiten der anderen – die sich also stärker verschuldet haben.
Die zweite Graphik zeigt, wie aggressiv die EZB die Bilanzsumme des Eurosystems seit der Lehman-Krise im Herbst 2008 erhöht hat. Handelte es sich zunächst noch um die üblichen, wenn auch großzügigeren und längerlaufenden Geldmarktoperationen, ist in diesem Jahr der direkte Ankauf von Anleihen hinzugekommen, auch solcher von zweifelhafter Bonität. In den USA war die Fed übrigens in jeder Hinsicht noch expansiver (Der Devisenmarkt hat es ihr übrigens mit einem superfesten Dollar-Wechselkurs gedankt! Das verstehe wer will).
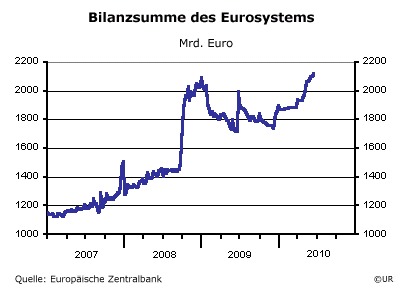
Michael Feroli von J.P.Morgan argumentiert weiter, dass sich Haushalte und Unternehmen nur dann reicher fühlen und mehr ausgeben, wenn die Notenbank glaubhaft machen kann, dass sie diese Aktiva, also ihre Forderungen, nicht eines Tages wieder geltend machen (verkaufen) wird. Nur dann nämlich hätte der Nominalwert ihres Nettovermögens zugenommen. Ihre zusätzliche Nachfrage träfe dann auf ein unverändertes Angebot an Gütern, und deren Preise gingen in die Höhe. Ziel erreicht! Es gibt aber nichts in den Statuten der führenden Notenbanken, die so etwas erlauben würden. Auch rein technisch geht es meiner Ansicht nach nicht. Es ist nicht möglich, Geld regnen zu lassen. „Helicopter money“ gibt es nicht, solange es in den Notenbankbilanzen Gegenposten gibt.
In der dritten Graphik ist zu sehen, dass im Euroland von der ganzen Expansion der Geldbasis und mit ihr der Notenbankbilanz nichts bei den Krediten oder M3 angekommen ist. Beide stagnieren seit Mitte 2008.
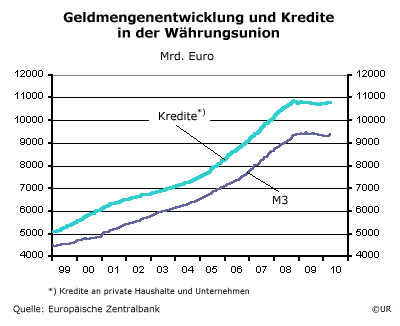
Die glücklichen Empfänger des Geldes haben nur einen weiteren Kredit erhalten, kein Geschenk. Es kann sogar sein, dass die Leute in Erwartungen späterer Steuererhöhungen (zum Abbezahlen der gestiegenen Staatsschuld) schon heute mehr sparen und die ganze Sache daher verpufft, es also nicht zu der gewünschten Inflation kommt. Der Begriff dafür heißt ricardianische Äquivalenz. Empirisch gibt es dafür allerdings bisher keine Belege.
Mit anderen Worten, weder die rekordhohe Neuverschuldung der Regierungen noch die ebenfalls rekordverdächtig expansive Geldpolitik haben bisher gezündet. Noch hat der Abbau der Schulden im privaten Sektor Priorität, scheint es.
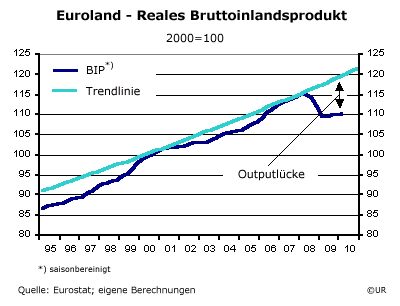
Die letzte Graphik zeigt, dass die Kapazitätsauslastung im Euroland trotz der konjunkturellen Erholung, die inzwischen immerhin in ihr zweites Jahr geht, nach wie vor sehr niedrig ist. Die Produktion liegt immer noch weit unter ihrem Potentialwert. Ähnliches gilt für den Arbeitsmarkt: Selten waren wir so weit entfernt von Vollbeschäftigung wie heute. Es ist daher weder möglich, die Output-Preise so zu erhöhen wie die Kosten des Inputs, insbesondere der stark verteuerten Importe, noch die Löhne über die Inflationsrate hinaus zu steigern (was andererseits ceteris paribus gut für die Gewinne ist).
Der Deflationsdruck bleibt bestehen.