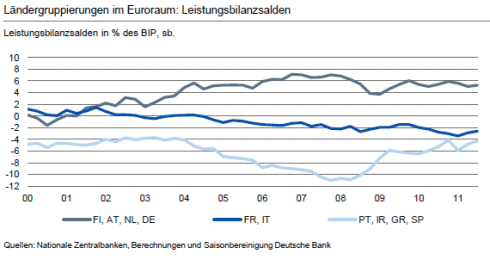Lehrbücher der Volkswirtschaftslehre beginnen meist mit Robinson Crusoe und seinen Kokosnüssen. Robinson sitzt auf seiner Insel und kann sich nun überlegen, ob er seine Früchte aufisst oder sie einpflanzt, damit sie sich vermehren. Isst er sie alle auf, hat er morgen nichts mehr zu essen. Pflanzt er sie ein, wird er vielleicht heute nicht statt, dafür verhungert er morgen nicht.
Deutschland hat seit dem Ende des zweiten Weltkriegs ziemlich viel gepflanzt und ziemlich wenig gegessen – und für die von Hans-Werner Sinn und anderen angestoßene Debatte über Risiken aus der Euro-Rettung ist das ein sehr wichtiger Befund.
Auch Länder stehen in gewisser Weise vor der Frage, die Robinson zu beantwortet hatte. Sie können ihre Ersparnisse im eigenen Land bilden, oder sie können in anderen Ländern investieren. Deutschland hat wenn man so will praktisch seit Kriegsende unter seinen Verhältnissen gelebt: Die Deutschen wurden zu einer der größten Gläubigernationen der Welt. Die sogenannte Nettoauslandsposition – die Forderungen an Ausländer abzüglich der Verbindlichkeiten – belaufen sich aktuell auf 877 Milliarden Euro.
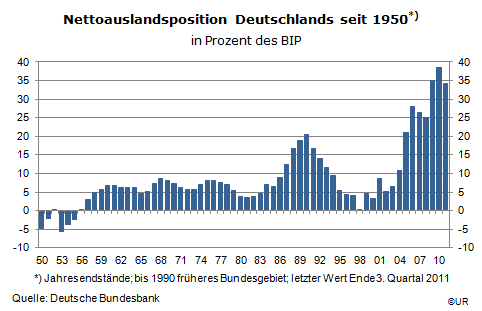
Man kann diesen bemerkenswerten Sachverhalt mit deutschen Tugenden erklären, mit der Wirtschaftsstruktur – die entscheidende Frage aber lautet: Ist es sinnvoll?
Für alternde Gesellschaften kann es sich tatsächlich auszahlen. Es ist ja eine Propagandalüge der Finanzindustrie, dass durch privates Vorsorgen gegen den demographischen Wandel anzukommen wäre. Der Wohlstand einer Nation lässt sich nicht speichern und in die Zukunft transferieren. Er muss in jeder Periode erzeugt werden und dafür sind reale Ressourcen nötig. Eine geschlossene Volkswirtschaft insgesamt kann im konventionellen Sinn überhaupt nicht sparen. Wenn morgen auf einen Arbeitnehmer tausend Rentner kommen, dann werden die Rentner in Armut leben – auch wenn sie fleißig geriestert haben. Es wird einfach niemanden geben, der die Waren herstellen kann, die sie so dringend brauchen.
Es sei denn, das Geld wurde im Ausland angelegt und begründet damit Ansprüche auf die künftigen Erträge dort. Denn dann müssten bei Auflösung der Ersparnisse die – hoffentlich produktiveren oder jüngeren – Ausländer die Waren erzeugen, die die deutschen Rentner aufbrauchen. Demographische Arbitrage heißt das und es bedeutet: Der Rollator wird in Indien oder Italien gebaut, aber in Deutschland eingesetzt. Der Konsumverzicht heute bedeutet Mehrkonsum in der Zukunft.
Soweit die Theorie. Das Dumme ist nur, dass eine Forderung auch eingetrieben werden muss. Das ist schon im eigenen Land nicht immer leicht, und im Ausland noch viel schwerer – zumindest, wenn man Krieg als Option ausschließt. Staaten können sich für zahlungsunfähig erklären oder sie können einfach ihre Währung abwerten. In beiden Fällen ist das Geld weg.
Wenn Sinn und andere nun argumentieren, der Zusammenbruch des Euro-Raums bedrohe unsere Renten und Lebensversicherungen, weil dann Italien und Spanien nicht mehr zahlungsfähig seien und dort viel deutsches Kapital angelegt wurde, dann ist das korrekt.
Aber was folgt daraus?
Ein Unternehmen ist pleite, wenn das Vermögen nicht mehr ausreicht, um die Verbindlichkeiten zu decken. Pleite in diesem Sinne sind Länder nur in den seltensten Fällen. Ein großer Teil des Geldes aus dem Norden wurde im Süden verjuxt: Man baute Olympiastadien und betonierte die Costa Brava zu. Jetzt sind die Stadien leer und die Costa Brava ist es auch. Die spanischen Arbeitnehmer aber sind deshalb nicht verschwunden. Es gibt sie immer noch. Sie können viele nützliche Dinge herstellen. Sie würden es auch gerne tun – aber das geht nicht, weil die Wirtschaft noch ganz auf den Bauboom ausgerichtet ist, so wie sich Metallspäne nach einem Magneten ausrichten.
Den Magneten kann man drehen, eine Wirtschaft auch – nur braucht sie etwas länger. Wenn das stimmt, dann wäre es sinnvoll zu helfen, damit die Spanier wieder auf die Beine kommen und ihre Schulden durch den Export von Waren bedienen können. So wie jeder kluge Gläubiger im Ernstfall Aufschub gewährt, weil er im Fall einer Insolvenz viel mehr verliert.
Es bedeutet natürlich, dass zunächst einmal mehr deutsches Geld im Risiko steht – über die Rettungsschirme etwa oder die Refinanzierungsoperationen der Europäischen Zentralbank. Doch man könnte diese Mittel als eine Investition in die Zukunft betrachten, die der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit unserer wichtigsten Handelspartner dienen (und übrigens ist die gesamte europäische Integration darauf angelegt, die Vernetzung zwischen den Ländern zu erhöhen. Wenn jetzt gewarnt wird, Deutschland werde durch die Hilfen erpressbar, dann ist das so, als würde man davor warnen, das Alkohol betrunken machen kann. Die „Erpressbarkeit“ ist die logische Folge der Aufhebung der Grenzen in Europa – sie existiert auch ohne Hilfszahlungen und sie verschwindet, wenn Europa und nicht mehr Deutschland als Referenzgröße betrachtet wird).
Es gibt Indizien dafür, dass die Rechnung aufgeht. In fast allen Ländern des Südens werden weniger Ersparnisse aus dem Ausland in Anspruch genommen. „Die Leistungsbilanzungleichgewichte zwischen den verschiedenen Mitgliedsstaaten des Euroraums kommen allmählich wieder ins Lot“, stellt die Deutsche Bank in einer neuen Studie völlig korrekt fest. Wer dagegen jetzt den Moralischen macht und den Südländern die Kredite kappt – und sie damit womöglich aus dem Euro-Raum verbannt –, wie es Hans-Werner Sinn zu fordern scheint, der verantwortet die Auslöschung des deutschen Auslandsvermögen. Sie werden in einem Währungschaos epischer Dimension in Rauch aufgehen, beziehungsweise in Lire und Escudo.
Und ist es aus einer engen nationalen Sicht nicht sogar ganz tröstlich, dass wir in der Währungsunion die für die Schuldner angenehmste Form der Schuldenvernichtung – die Währungsabwertung – verhindern können? Denn jede Abwertung ist Betrug am Gläubiger. Anders gesagt: Über den Euro zwingen wir Italiener, Griechen und Spanier dazu, hart zu arbeiten, damit sie uns unser Geld zurückzahlen. Die Amerikaner werden immer bezahlen – aber womöglich in wertlosen Dollars. Die Sicherung des deutschen Auslandsvermögens ist jedenfalls kein gutes Argument gegen die Euro-Rettung.
Ganz egal wie die Entscheidung ausfällt: Sie muss entschlossen umgesetzt werden. Wer erst rettet und dann alle drei Monate mit Hilfeentzug droht, weil irgendwo eine Defizitvorgabe nicht eingehalten wird, der gefährdet den Erfolg der Unternehmung. Niemand wird in Griechenland investieren, solange der Euro-Austritt wie das Schwert des Damokles über dem Land hängt.
Die Unsicherheit lähmt die Finanzmärkte und die gesamte Gesellschaft und jede Drohung mit Insolvenz schwächt das Land und rückt die Rückzahlung der Hilfen noch weiter in die Ferne. Wenn die Unternehmen wie derzeit in Griechenland nicht einmal mehr einen einfachen Bankkredit bekommen, dann werden auch Lohnkürzungen die Wirtschaft nicht voranbringen.
Retten heißt loslassen – und wenn wir das nicht können, dann sollten wir die Sache beenden.
Der zentrale Konstruktionsfehler der Währungsunion war nicht der zahnlose Stabilitätspakt, sondern die Abwesenheit eines Regimes zur Kontrolle der grenzüberschreitenden Kapitalströme. Es wäre für alle besser gewesen, wenn die Deutschen mehr ihrer Ersparnisse im eigenen Land gebildet hätten (idealerweise so, dass die wenigen Arbeitnehmer in der Zukunft produktiver werden und mehr Rentner ernähren können) und die Spanier weniger davon verjubelt hätten.
Sehr wahrscheinlich hat das auch etwas mit dem Euro zu tun, denn die Auslandsforderungen der Deutschen stiegen seit Einführung der gemeinsamen Währung besonders stark. Es ist diskurstheoretisch interessant, dass diejenigen, für die die Stärkung der Binnennachfrage und die Abkehr von der Exportabhängigkeit linkskeynesianisches Teufelszeug ist – wie die Wirtschaftsredaktion der FAZ – nun plötzlich die Konsequenzen eben jener Exportabhängigkeit nicht akzeptieren wollen. Der Schlamassel wäre wesentlich kleiner, wenn wir zwischendrin statt auf Hans-Werner Sinn (der vor nicht langer Zeit noch vor der „nachlassenden Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft“ warnte und über den Untergang des Produktionsstandortes D sinnierte) auch einmal auf Oskar Lafontaine gehört hätten.
Doch erstens ist das ein technisches Problem, dass sich lösen lässt – zum Beispiel durch die Drosselung der Kreditvergabe in den Boomländern und deren Ankurbelung in den Krisenstaaten mittels der Vorschriften für die Eigenkapitalquote der Banken. Und zweitens ist es ein Thema für die Zukunft. Im Moment bekommen die Spanier nicht zu viel, sondern zu wenig Kredit und deshalb müssen wir ihnen beistehen.
Man kann das Konkursverschleppung nennen – oder Makroökonomie.